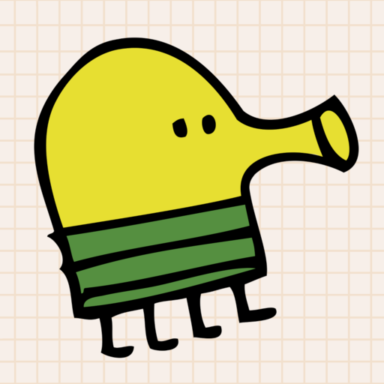A Short Introduction to the Politics of Cruelty
Insurrectionary Foucault: Tiqqun, The Coming Insurrection, and Beyond

Bemerkungen zu Anwar Shaikhs Buch: Capitalism: Competition, Conflict, Crises (1)

Der marxistische Ökonom Anwar Shaikh hat ein monumentales Buch geschrieben. Sein mehr als tausend Seiten umfassendes Werk Capitalism. Competition, Conflict, Crises ist alles andere als ein Lehrbuch und setzt Grundkenntnisse der Neoklassik, des Keynesianismus und der marxistischen Theorie voraus. Angereichert ist es zudem mit einem anspruchsvollen mathematischen Apparat, der sich allerdings alles andere als ein Selbstzweck erweist.
Auf den ersten Blick zeichnet sich die Geschichte der entwickelten kapitalistischen Welt durch ein stetiges Wachstum aus, was Lebensstandard, Produktivität und Welfare betrifft, und dies macht den Aspekt der Ordnung des ökonomischen Systems aus. Je näher man aber hinschaut, desto stärker trifft man auf Armut, Migration und Klassengegensätze, und dies markiert die Unordnung des ökonomischen Systems. Anwar Shaikh, der durch das gesamte Buch souverän zwischen neoklassischer, keynesianischer und postkeynenisianischer und schließlich klassischer Ökonomie (zu dessen Berfürworter er sich selbst zählt; Smith, Ricardo und insbesondere Marx) pendelt, resümiert zunächst die Positionen der ersten beiden Lehren hinsichtlich des Verhältnisses von Ordnung und Unordnung.
Die Neoklassik behauptet, dass das ökonomische System alle Preise für vergleichbare Güter, alle Löhne für vergleichbare Arbeit und alle Profitraten für vergleichbare Risiken angleicht. Alle verfügbaren Ressourcen werden genutzt inklusive der Fabriken, der Arbeit und des Equipments. Nur in Folge dieser je schon gültigen und etablierten Konzeption kann es zu Abweichungen kommen. Die heterodoxe, insbesondere die keynesianische Ökonomie, nimmt die entgegengesetzte Position ein. Anstatt des perfekten neoklassischen Wettbewerbs haben wir es hier mit dem unvollkommenen Wettbewerb zu tun. Anstatt Vollbeschäftigung registrieren wir Arbeitslosigkeit - Marktergebnisse erscheinen als konditional - sie sind von der Politik, den Chancen, der Geschichte und nicht zuletzt von der Macht abhängig, sei es Klassenmacht, oligopolistische Macht oder Staatsmacht. Was die Neoklassik als geordnete Patterns oder Muster begreift, das erscheint im Keynesianismus als kontingent und abhängig vom Spiel der Kräfte. Es gibt hier stets einen verhandelbaren Raum, um den Gap zwischen den aktuellen und gewünschten Ereignissen zu schließen. Was die Neoklassik mit der Wirkung der unsichtbaren Hand des Marktes verspricht, das will die keynesianische und postkeynesianische Ökonomie durch die sichtbare Hand des Staates erreichen. Für Shaikh besteht nun die Ironie genau darin, dass beiden Seiten darin übereinstimmen, die ökonomische Realität durch eine a-perfekte Brille anzuschauen. Während die Neoklassik von einer vollkommenen Ordnung ausgeht und Abweichungen als mögliche Modifikationen einer unterliegenden Theorie einführt, will die heterodoxe Ökonomie das perfekte Stadium nur für eine frühe Phase des Kapitalismus anerkennen, während unvollkommene Regeln die gegenwärtige ökonomische Welt beherrschen.
Shaikh erzählt eine ganz andere Geschichte, eine Ökono-Fiktion, die aber stets auf die Empirie bezogen bleibt. Ihm geht es um eine Theorie, die der realen Entwicklung des Kapitals vom ersten Moment bis heute angemessen ist. Das Objekt der Untersuchung ist weder das Perfekte noch das Unvollkommene, sondern das Reale. Deshalb müssen die von Shaikh entwickelten theoretischen Argumente sich permanent der empirischen Analyse stellen. Das ökonomische System des Kapitals erzeugt machtvolle und geordnete Muster und Patterns, die historische und lokale Partikularitäten transzendieren, das heißt sie kanalisieren die historischen Pfade der wichtigsten ökonomischen Variablen, wobei die gestaltenden Kräfte selbst Resultate bestimmter immanenter Imperative sind. Dabei geht es nicht darum, ahistorische Gesetze mit historisch kontingenten Ergeignissen zu konfrontieren, vielmehr existieren Agenten und Gesetze in einer multidimensionalen Struktur von Einflüssen, wobei die Struktur hierarchisch geordnet ist, das heißt bestimmte Kräfte wie das Profitmotiv machtvoller als andere sind. Die resultierende systemische Ordnung wird in-und-durch eine kontinuierliche Unordnung erzeugt, wobei die letztere der immanente Mechanismus ist. Wenn Ordnung nicht synonym mit Optimum gesetzt werden kann, so Unordnung nicht mit der Abwesenheit von Ordnung. Für Shaikh lässt sich eine große Bandbreite von Phänomenen durch ein kleines Set von operativen Prinzipien erklären, wobei aktuelle Ereignisse um die je sich schon bewegenden Zentren der Gravitation kreisen. Diese nennt Shaikh den systemischen Modus einer turbulenten Regulation, dessen chrakteristischer Ausdruck die Form der Wiederholung von Patterns annimmt.
Die turbulente Regulation und die Wiederholung von Mustern gelten als die gravitationalen Tendenzen des ökonomischen Systems. Es geht zum ersten um die Bestimmung von Warenpreisen, Profitraten, Lohnraten, Zinsraten und Wechselkursen. Diese Prozesse haben zwei Tendenzen: 1) Ausgleichende Tendenzen durch die rastlose Suche nach monetären Vorteilen, deren unintendiertes Resultat in der Bereinigung der Differenzen besteht, die diese wiederum motivieren. 2) Gestaltende Tendenzen, die den Pfad bestimmen, um die die ausgleichenden Bewegungen operieren. So lassen die ausgleichenden Tendenzen individuelle Löhne und Profitraten um den Durchschnitt gravitieren. Während die durchschnittliche Lohnrate von der Produktivität, Profitabilität und den Klassenkämpfen zwischen Arbeitern und Kapitalisten abhängig ist, sind die durchschnittlichen Profitraten von den Löhnen, der Kapitalintensität und der Produktivität abhängig. Diese Durchschnitte sind das Resultat von mikroökonomischen Interaktionen, bei denen die Konkurrenz die entscheidende Rolle spielt. Beide Prozesse subsumiert Shaikh unter dem Begriff der realen Konkurrenz, bei der wiederum das Profitmotiv die zentrale Rolle spielt. Das zweite Set der gravitationalen Tendenzen umfasst die turbulente Makrodynamik des Systems inklusive seiner expansiven Prozesse des Wachstums und umgekehrt die der Stagnation. Auch hier ist das Profitmotiv der dominante Faktor, der für die Regulation der Investititionen, des Wachstums, der Zyklen, der Beschäftigung und der Inflation verantwortlich in letzter Instanz ist.
Die Zentralität des Profitmotivs besitzt mehrere Implikationen. 1) Die Theorie des Profits und der Löhne. 2) Die Rolle der Profitablität für den realen Wettbewerb, insofern alle Momente der Firmen betroffen sind, was zur Theorie des konkurrenzbestimmten Preises und der Theorie des endogenen technischen Wandels führt. 3) Zudem reguliert die erwartete Profitrate das Investment sowie das Wachstum und betrifft auch das Verhältnis von aggregierter Nachfrage und aggregiertem Angebot. Profit reguliert Angebot und Nachfrage.
Bezüglich der empirischen Evidenz seiner Position, wobei die Empirie nie aus einer Sammlung von präexistierenden Fakten besteht, merkt Shaikh an, dass Theorie hier weniger durch Interpretation, sondern durch Repräsentation von empirischen Ereignissen interveniert. Shaikh gliedert sein mehr als 1000 seitiges Buch in drei Parts auf: Die Grundlagen der Analyse, die Theorie des realen Wettbewerbs und die Theorie der turbulenten Makrodynamik. Jeder Part ist wiederum in fünf Kapitel aufgeteilt.
Im ersten Kapitel untersucht Shaikh zuerst die empirischen Evidenzen der langfristigen Muster der entwickelten kapitalistischen Ökonomien, und dies bezüglich des persistierenden Wachstums der Outputs, der Produktivität, des Profits und der Beschäftigung; Prozesse, die die in und durch sich wiederholende Zyklen und periodisch große Derpressionen stattfanden; er untersucht die sozial beeinflusste Relation von Löhnen zur Produktivität, den Einfluss des Staates auf Unterbeschäftigung, die Wiederkehr der goldenen langen Wellen, die Impikationen des Wachstums in den langfristigen Pfaden der Profitabilität, den turbulenten Ausgleich der Rentabilität durch alle industrielllen Sektoren, die strukturelle Determination der industriellen Preise und schließlich die steigende Ungleichheit der Einkommens- und Vermögensverteilung.
Danach beschäftigt sich Shaikh mit den entsprechenden methodischen Problemen. Die konventionelle Auffassung vom Gleichgewicht als einem Stadium der Ruhe wird durch die Auffassung von turbulenter Regulation ersetzt, bei der eine Balance nur durch sich wiederholende Unter- und Überschreitungen erzielt wird. Dies wirft das Problem der Zeitlichkeit und der Nonlinearität der Prozesse auf, als auch die Frage, wie wiederholende Muster und Patterns über lange Zeiträume bestehen können, wenn sie doch aus einer Vielzahl von individuellen Interaktionen, die in soziale Strukturen und Kämpfe eingebettet sind, komponiert werden. Die neoklassische Antwort besteht in der Konstruktion eines unwandelbaren repräsentativen Agenten, der durch hyperrationale Wahl für bestimmte ökonomische Ergebnisse sorgt. Dabei haben alle Agenten einer Gruppe als identisch zu gelten. Nonlineares Verhalten taucht nicht auf. Stattdessen gilt es für Shaikh nachzuweisen, dass aggregierte Ergebnisse ermergente Eigenschaften besitzen, i.e. das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Gesetzesartige Muster können gerade deshalb aus hetorogenen Einheiten - seien es Individuen oder Firmen, die mit verschiedenen Strategien und konfligierenden Erwartungen arbeiten - emergieren, weil makroökonomische Ergebnisse robust indifferent gegenüber mikroökonomischen Details sind. Die Diversität erzeugt statistische Verteilungen von Ergebnissen, wobei Durchschnitte durch soziale Strukturen erzeugt werden. So kann das aggregierte Konsumverhalten (abwärts verlaufende Nachfragekurven, Elastrizitäten bezüglich notwendiger Güter und Luxusgüter, die Nonlinearität der Engels Kurve) ohne Referenz auf ein partikuares Modell des Konsumverhaltens abgeleitet werden.
Weiterhin untersucht Shaikh die Strukturen der sozio-ökonomischen Produktion. Die Neoklassik präsentiert den Austausch von Äquivaenten als das zentral organisierende Prinzip, wobei die Produktion als Mittel eines indirekten Tauschs zwischen Gegenwart und Zukunft erscheint. Für Shaikh, der hier die klassische Position vertritt, benötigt die Produktion stets Zeit; sie geht dem Tausch der Produkte voraus. In der Produktion findet der Kampf um höhere Löhne und um die Verringerung der Arbeitsintensität statt. Shaikh kontrastiert diese Merkmale gegen die zeitlosen Input-Output Methodologien der meisten anderen ökonomischen Traditionen. Desweiteren besitzt die Unterscheidung zwischen zirkulativem und fixem Investment große Bedeutung für die ökonomische Dynamik. Dabei geht es darum zeigen, wie die Nutzung des Materials, des fixen Kapitals und der Arbeit auf die Länge und die Intensität des Arbeitstags bezogen ist (es gibt differente Levels der Nutzung), womit die neoklassische mikrökonomische Produktionsfunktion dekonstruiert wird. Die Einbeziehung von sozialen Komponenten zeigt an, dass man weder variable noch fixe Koeffizienten-Modelle voraussetzen kann, die ausschießlich technologische Bedingungen repräsentieren. Die von Shaikh dargestellten Kostenkurven unterscheiden sich signifikant von denen der mikroökonomischen Lehrbücher. Die in der Neoklassik favorisierte U-Kostenkurve taugt nichts, vielmehr zeigen Kostenveränderungen von einer Ebene zur nächste Ausschläge in den variablen Kosten und scharfe Sprünge in den marginalen Kosten an. So kann ein gegebener Preis marginale Kostenkurven mehrmals durchschneiden, sodass die Regel p=mc keinen Hinweis auf den profit-maximalen Punkt der Produktion gibt.
Jedes Unternehmen antizipiert den Profit bezüglich des Verkaufs eines geplanten Produkts und antizipiert zeitgleich den Kauf anderer Produkte als zukünftige Inputs oder als Konsumtion. Die Neoklassik behauptet nun, dass die individuelle Produktionsplanung vorzüglich mit sozialen Notwendigkeiten übereinstimme. Dieser Anspruch kulminiert im allgemeinen Gleichgewicht. Hingegen wird die turbulente Ordnung, die aus den realen Märkten emergiert, in-und-durch-Unordnung erzeugt, wobei Geld als der allgemeine Agent fungiert. Tausch sollte nicht mit reziproken Gaben verwechselt werden. Im Tausch versucht jede Partei mehr zu bekommen als wegzugeben. Eine einseitige Zahlungsverpfichtung (Steuern) sollte nicht mit Schulden verwechselt werden. Diese sind Tilgungsverpfichtungen, ein Rückfluss von Zinsen und Amortisationen. Barter ist die erste Form des Tauschs, indem er multiple Tauschrelationen und -raten zwischen Waren fundiert, wobei Geld dann auftaucht, wenn die Streuung des Tauschs so ausgeweitet wird, dass es notwendig ist, die vielen Tauschraten einer gegebenen Ware mit anderen Waren in eine einzige Rate und eine einzige Bezugsware zu konvertieren; bspw. kann Salz diese einzige Ware sein und alle anderen Waren innerhalb seiner Sphäre erhalten dann einen Salz-Preis. Diese exklusive Ware bezeichnet Shaikh ganz konventionell als Geldware. Der Preis ist der monetäre Ausdruck des quantitativen Werts einer Ware.
Shaikh zeichnet die historische Entwicklung des Geldes nach, was ihn hin zu einem Statement über die drei Funktionen des Geldes führt: Recheneinheit, Wertaufbewahrungsmittel und Zirkulationsmittel. Für Marx gibt es zwei bestimmende Momente in der Determination des nationalen Preislevels: die wettbewerblich determinierten relativen Preise der Waren bezüglich einer historisch gewählten Geldware wie Gold, und der Preis der Geldware, der durch monetäre und makroökonomische Faktoren determiniert wird. Weiter untersucht Shaikh die Behandung des Fiatgeldes in einem System mit einer Geldstandardware (Gold), und dies bezglich Sraffas Behandlung der relativen Preise der Produktion. Was passiert aber, wenn Fiatgeld nicht mehr an eine Geldware gebunden ist? Unter den Bedingungen des modernen Fiatgeldes wird dann das nationale Preislevel direkt von makroökonomischen und monetären Faktoren determiniert, aber anders als sich das die Keynesianer, Monetaristen und Postkeynesianer vorstellen.
Die Analyse von Profit und Kapital erfordert zunächst die begriffliche Definition von Kapital und der Determination des aggregierten Profits. Selbst Keynes bezeichnet diesbezüglich die Marx`sche Formel G-W-G` eine als brauchbare Methode, um das Kapital zu identifizieren. Es geht beim Kapital nicht um die Qualität eines Dings, sondern um einen sozialen Prozess, in dem es operiert, um als Kapital herauszukommen. Kapital wird auch nicht durch seine Dauer gekennzeichnet. Zirkulierendes Kapital mag nur wenige Tage, fixes Kapital aber Jahre im Produktionsprozess bleiben. Manche haltbaren Güter sind Teile des persönlichen Reichtums, wie etwa ein Auto, während es für einen Automobilverkäufer als Kapital fungiert. Die Neoklassik vermischt Kapital und haltbare Güter, weil sie Kapital als den Reichtum definiert, der länger als ein Jahr hält. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung unterstützt die Neoklassik, insofern sie private Hauseigentümer als Personen behandelt, die ihre Häuser an sich selbst vermieten.
Weiter zeigt Shaikh, dass es zwei Quellen des aggregierten Profits gibt, wobei die erste sich auf den Transfer des Reichtums (merkantiles Kapital) und die zweite sich auf die Produktion neuen Reichtums in der Form des Mehrwerts (industrielles Kapital) bezieht. Ein Surplusprodukt kann nur dann erzeugt werden, wenn die Länge des Arbeitstags die Arbeitszeit übersteigt, die für die Reproduktion des durchschnittlichen Lebensstandards der Arbeiter notwendig ist. Der aggregierte Profit ist unabhängig von den relativen Preisen gleich Null, wenn das Surplusprodukt gleich Null ist. Positiver aggregierter Profit existiert nur, wenn das Surplusprodukt und die Surplusarbeit exisitieren, wobei hier eine Verdopplung des Preislevels lediglich zur Verdopplung der Kosten führt. Im Fall eines gegebenen positiven Surplusprodukts kann eine Veränderung in den relativen Preisen den aggregierten Profit verändern. Profit bezieht sich dann zwar immer noch auf die Surplusarbeit, aber nun kommt die Zirkulation ins Spiel. Für Shaikh gibt es deshalb ein Transformationsproblem. In ganz klassischer, an der Arbeitswerttheorie orientierter Weise erklärt Shaikh, dass die aggregierten Profite variieren, wenn man von sich Preisen, die proportional zum Arbeitswert zu betrachten sind, hin zu Produktionspreisen bewegt. Und dasselbe lässt sich sagen, wenn man sich von Produktionspreisen, die immer theoretische Konstrukte sind, zu Marktpreisen oder Monopolpreisen hin bewegt. Zudem führt die Veränderung der relativen Preise der Waren zur Veränderung des Verhältnisses der Kreisläufe von Kapital und Revenue. Obgleich hier die Wertsummen gleich bleiben, führt die Veränderung zu solchen der aggregierten Profite. Hier siedelt Shaikh auch den finanziellen Profit an. Wenn man die Profitrate als das Verhältnis zwischen monetärer Größe des totalen Produkts und den aktuellen Kosten für Material, Abschreibung und Arbeit anschreibt, dann handelt es sich um die reale Profitrate. Den Zähler oder Nenner durch einen gemeinsamen Preisindex zu deflationieren, berührt die Rate selbst nicht. Shaikh geht in den verschiedenen Appendixen auf die diversen Methoden zur Messung der Profitrate ein. Seine eigene Methode hat im Unterschied zu konventionellen Messmethoden zum Ergebnis, dass in den USA die Maximum-Profitrate der Unternehmen seit 1947 ständig fällt, wobei der technologische Wandel auch die durchschnittliche Porduktivität des Kapitals sinken lässt. Auch der operative Nettosurplus fällt von 1947 bis 1982 leicht, bevor er aufgrund der neoliberalen Politiken, die die Lohnrate senken, leicht zu steigen beginnt.
Foto: Bernhard Weber
Bemerkungen zu Anwar Shaikh`s „Capitalism: Competition, Conflict, Crises“ (2)

Im zweiten Teil des Buches präsentiert Shaikh seine Theorie des realen Wettbewerbs. Das Profitmotiv ist inhärent expansionistisch. Investoren versuchen aus ihren Projekten mehr Geld herausuzuholen als sie hineingesteckt haben, und wenn sie erfolgreich sind, dann tun sie dies auf höherer Ebene erneut, wobei sie mit anderen Investoren kollidieren, die dasselbe tun. Einge sind erfolgreich, andere überleben gerade mal und manche verlieren. Dieser Prozess kennzeichnet den realen Wettbewerb, der antagonistisch per se und turbulent in seinen Operationen ist. Für Shaikh ist dies der zentrale Mechanismus des Kapitals, der vom perfekten Wettbewerb so verschieden ist wie der Krieg vom Ballett. Die Konkurrenz zwingt die Unternehmen dazu, Preise zu setzen, die sie im Spiel halten, und die Kosten zu senken, sodass sie auch die Preise derart senken können, dass sie im Wettbewerb bleiben. Die Kosten können zunächst durch die Senkung der Löhne oder die Verlängerung des Arbeitstags oder die Steigerung der Arbeitsintensität fallen, oder zumindest dadurch, dass man die Löhne im Verhältnis zur Produktivität senkt. Weil man mit Reaktionen der Arbeiter rechnen muss, wird für ein Unternehmen langfristig der technologische Wandel das zentrale Mittel sein, um die Kosten zu senken. In diesem Kontext machen Unternehmen ihre Planungen in Hinsicht auf eine intrinsisch unsichere Zukunft. Shaikh resümiert: Konkurrenz ist der Krieg aller gegen alle.
Der reale Wettbewerb generiert speziele Muster und Patterns. Die Preise, die durch verschiedene Anbieter in derselben Branche gesetzt werden, gleichen sich ungefähr aus - gemessen an der Mobilität der Kunden - und die Profitraten auf neue Investments in den verschiedenen Branchen werden auch ungefähr angeglichen - gemessen an der Mobilität des Kapitals, das auf höhere Profite abzielt. Beide Prozesse inhärieren Bewegungen um ein korrespondierendes, gemeinsames Zentrum. Diese Konzeption des turbulenten Ausgleichs widerspricht der gängigen Lehrmeinung, die das Gleichgewicht als ein Stadium der Ruhe bezeichnet. Zwar spielen Angebot und Nachfrage eine Rolle, aber nicht grundlegend, insofern beide Komponenten durch Preissetzungen und Ein- und Austritte von Unternehmen affiziert werden. Der Ausgeich von Preisen und Profitraten inhäriert emergente Eigenschaften, sie sind unintendierte Resultate eines konstanten Kampfes um höhere Profite.
Die Benennung dieser Konkurrenz als Krieg enthält entscheidende Implikationen. Jedes wettbewerbsorientierte Unternehmen muss sich um Taktiken, Strategien und Einschätzungen der Zukunft kümmern. Man kann deshalb weder von einem normalen Profit sprechen, noch davon, den Zins als Teil der Kosten einzuführen. Die Teilung zwischen Schulden und Eigenkapital (Equity) determiniert die Teilung des operativen Nettoprofits in Zins und Profit. Die Zinsrate fungiert hier als Indikator für den Gap zwischen aktivem und passivem Investment. Unternehmen sind preissetzende Organisationen, die ihre Preise an denen der Preisleader orientieren müssen. Extraprofite in einer Industrie stimulieren die Adaption der effizientesten Methoden durch Insider und Outsider, wobei neue Firmen dazu tendieren, die Preise zu unterbieten und damit die Extraprofite zu eliminieren. Dieses Verhalten im Wettbwerb weist darauf hin, dass erhebliche Differenzen in den Kosten exsitieren. Profitablere Industrien weisen laut Studien von Bryce and Dyer fünfmal soviel Neuzugänge von Firmen als durchschnittliche Branchen auf. Die Firmen mit der höchsten Produktivität arbeiten mit den besten Technologien, wobei es immer eine gewisse Bandbreite von Technologien in einer Branche gibt. Laut Salter lassen sich die Veränderungen in den relativen Preisen meistens mit der Veränderung der relativen Arbeitsproduktivität erklären, wobei diese vom technischen Wandel stimuliert wird. Dabei fällt mit der Frirmengröße die Profitrate, aber eben auch die Risiken und die Kapitalkosten. Untersuchungen zeigen, dass bei Firmen im Schnitt die Output-Kapital Rate steigt, während die Rate Kosten-Kapital ungefähr konstant bleibt. Dabei besitzen neue Firmen höhere Skalen und niedrigere Kosten pro Einheit Output, was es ihnen erlaubt, niedrigere Preise zu setzen. Größere Firmen haben es mit einer steigenden Kosten-Kapital Rate zu tun, was Konsequenzen für den Pfad der Profitrate hat.
Die klassische Theorie geht davon aus, dass neue Investments in effizientere Fabriken und Ausstattungen erfolgen. Weil jedes Unternehmen eine Vielzahl von Technologien und Modellen anwendet, lässt sich die Durchschnittsprofitrate einer Firma nicht als Annäherung für seine regulierende Rate begreifen. Ein ähnliches Problem taucht auf der Ebene der Branche auf: Das relevante Maß ist hier die Rendite bezogen auf neue Investments bzw. die reale stufenweise Rendite bezogen auf das Kapital, die als die Veränderung des realen Profits im Verhältnis zum Investment erscheint. Im empirischen Studien weist Shaikh nach, dass die duchschnittlichen Profitraten dazu tendieren unterschiedlich zu bleiben, während die inkrementellen Profitaten sich ausgleichen.
Weiter untersucht Shaikh, wie die regulierenden bzw. dominanten Kapitale den Wettbewerb durch die Wahl der jeweiligen Techniken gestalten. Dabei werden aktuelle Entscheidungen ausgehend von gegenwärtigen und zukünftig zu erwartetenden Marktpreisen getroffen (wobei Produktionspreise und Marktpreise, die um die ersteren gravitieren, unterschieden werden müssen). Dabei müssen Firmen möglichst die niedrigsten Kosten für Material, Abschreibung und Löhne wählen. Da die Märkte turbulent sind, muss diese Wahl robust sein, das heißt effizient bei normaler Fluktuation der Kosten, der Preise und der Profitraten. Dabei ist die Wahl der Techniken stochastisch, nicht deterministisch. Wenn bspw. niedrigere operative Stückkosten durch höhere Stückkosten des Kapitals (Technologie, die das Verhältnis Kapital-Kosten steigen lässt) erreicht werden, dann führt dies zu einem Fall der Durchschnittsprofitrate bei gegebenen realen Löhnen (im Gegensatz zu den Annahmen Okishios).
Die Marx`sche Konzeption der Konkurrenz betont den anarchischen Charakter der gravitationsbedingten Fluktuationen. Dass die Bedingungen der Produktion den Marktpreis diktieren, übernimmt Marx von Ricardo, und erweitert dessen These über die Agrikultur hinaus auf alle Industrien. In diesem Rahmen sind die Unternehmen aktiv preissetzende und agressiv kostensenkende Instanzen, wobei die Kreation neuer Techniken mit niedrigeren Produktionskosten ein höheres Investment an fixem kapital pro Einheit erfordert. Dagegen setzt die Neoklassik das Unternehmen als einen passiven Preisnehmer und die Konkurrenz als Gleichheit qua Gleichgewicht (Jevons und Walras). Shaikh zeigt, dass die Annahme des vollkommenen Wettbewerbs irrational ist. Wenn alle Unternehmen als gleich angenommen werden, dann müssen sie dieselben Aktionen unternehmen, i.e. jedes Signal, das ein Unternehmen aufruft, den Output zu erhöhen, muss von allen Firmen aufgenommen werden, die dann ebenfalls den Output erhöhen, sodass das Angebot signifikant steigt und die Preise fallen. Wenn die Firmen im vollkommenen Wettbewerb zudem perfekt informiert sind, dann wäre es für ein Unternehmen ziemlich irrational anzunehmen, dass es soviel wie es will zu einem von ihm selbst gewählten Preis verkaufen könnte. Das ist aber gerade das, was die Theorie vom vollkommenen Wettbewerb und die auf ihr basierende Makrökonomie einfordert. Daraus folgt, dass die Theorie der rationalen Erwartung nicht durch die Theorie des vollkommenen Wettbewerbs fundiert werden kann. Die Firmen werden nämlich nicht mit horizontalen, sondern fallenden Nachfragekurven konfrontiert.
Weitergehend untersucht Shaikh zu diesen Topics die österreichische Schule um Schumpeter und die postkeyesianischen Theorien, insbesondere die von Kalecki. Zunächst affirmiert Kalecki die Theorie des vollkommenen Wettbewerbs, weist aber desweiteren darauf hin, dass im Zug der Zentralisation des Kapitals man es mit Monopolisierung zu tun bekomme. Der erste Bezugspunkt ist hier natürlich Hilferding, dessen Theorie von Lenin übernommen und erweitert wurde. Kaleckis monopolistische Preistheorie wurde die Basis für die marxistische Schule um Baran/Sweezy und für den Großteil der postkeynesianischen Theorien. Die bneoklassische Standardtheorie soll durch die Widerlegung einiger ihrer Grundannahmen reaistischer werden. Vollkommene Information wird durch Unsicherheit ersetzt, es wird auf Eintrittsbarrieren, störende Externalitäten und monopolitische Mark-ups hingewiesen, während das Prinzip der Profitmaximierung beibehalten wird. Die Bedingung p=mc wird durch mr=mc (Sraffa) ersetzt.Kalecki nimmt richtigerweise an, dass Firmen Preise setzen, und Firmen mit niedrigen Kosten niedrigere Preise setzen. Dies führt er jedoch auf die Preisfeststetzung durch Monopole zurück, wobei die langfristigen Profitraten zwischen den Marktführern differieren, und dies aufgrund ihrer jeweiligen Marktmacht. Shaikh geht es hingegen darum zu zeigen, dass im Rahmen des realen Wettbewerbs Marktpreise um die Produktionspreise kreisen, wobei die Abweichungen der Preise und der Profitraten um ihre regulierenden Zentren eine entscheidende Rolle spielen.
Shaikh unterscheidet zwischen vollkomenen, unvolkommenen und realem Wettbewerb. Im Konzept des vokommenen Wettbewerbs gibt es eine Vielzahl, in Größe und Kostenstruktur identische Firmen, die einer horizontalen Nachfragekurve gegenüberstehen. Sie sind passive Preisnehmer, die Technologie ist gegeben und der einheitliche Preis ergibt sich aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Sie besitzen dieselbe Profitrate. Die Theorie des unvollkommenen Wettbewerbs benutzt diese Bedingungen als Benchmark. Entscheidend ist hier, dass die Fähigkeit der Marktführer Preise festzusetzen als ein Indikator für Monopolmacht (in Relation zur Größe, Kapitalintensität und Marktanteil) gilt. Im realen Wettbewerb hängt die Intensität der Kämpfe weder von der Zahl der Unternehmen noch von ihrer Größe oder ihrem Marktanteil ab. Preissetzung, Kostenreduktion und technologische Variation gelten als intrinsische Faktoren der realen Konkurrenz. Innerhalb bestimmter Grenzen differieren die Marktpreise, wobei Firmen auf die Veränderungen des Angebots und der Nachfrage mit Justierungen der Preise reagieren. Neue Firmen tendieren zu höheren Skalenbeträgen und niedrigeren Kosten, um Kämpfe um Marktanteile durch Pressenkung austragen zu können, während ältere Firmen sich anpassen. Man erwartet eine postive Korrelation zwischen Verkaufspreisen und Stückkosten und eine negative zwischen jener Korrelation und der Firmengröße und Kapitalintensität. Wenn effizientere Firmen dahin tendieren, größer und kapitalintensiver zu sein, dann sind die Konzentrationsraten mit Eintrittsschranken korreliert.
Während man in der Theorie des volkommenen Wettbewerbs von identischen Profitraten ausgeht, in der Theorie des unvollkommenen Wettbewerbs von differenten Profitraten, so impliziert der Ausgleich der Profitraten in der Theorie des realen Wettbewerbs, dass die regulierenden Unternehmen mit hoher Kapital-Output-Rate höhere Gewinnspannen verzeichnen. Beim realen Wettbewerb werden die Profitraten der regulierende Kapitale in den verschiedenen Sektoren angeglichen. Ein Ausgeich der Profitraten impliziert, dass die Kapitalintensität dann nicht mehr korreliert. Insofern die Profitrate die Rate zwischen Gewinnspanne und Kapitalintensität ist, hängen die beiden letzten Parameter zusammen.
Für Shaikh sind Produktionspreise kompetitive relative Preise, die mit drei Prozessen in Verbindung stehen: Verkaufspreise, die durch Verkäufer angeglichen werden, Lohneinkommen werden durch Arbeit und durchschnittlliche Profitrate durch die regulierenden Kapitale angeglichen. Daraufhin zeigt Shaikh, dass die relevante Dispersion der Arbeit-Kapital-Rate nicht diejenige ist, die man direkt in einer Industrie beobachten kann, sondern es sind die ingegrierten Raten, der gewichtete Durchschnitt der Arbeit-Kapital Rate in einer jeweiligen Industrie plus ihrer Inputs, und der Inputs der Inputs etc.; der Produktionspreis jeder Industrie hängt zum ersten von der integrierten Arbeistzeit pro Einheit und zum zweiten von der integrierten Arbeit-Kapital Rate ab (Durchschnitt der Industrie und die Raten anderer Industrien, die anliefern) Da letztere sehr eng verteilt ist, schließt Shaikh auf ein enges Verhältnis von Produktionspreisen und intergierten Arbeitszeiten. Aufgrund empirischer Analysen vermutet Shaikh einen bestimmten Zusammenhang von Marktpreisen, Produktionspreisen und direkten Preisen (Preis proportional zu integrierter Arbeitszeit.) Shaikh erweist sich hier als Vertreter eines, wenn auch elaborierten Arbeitswertmarxismus.
Shaikh analysiert daraufhin die statistischen Korrelationen zwischen den Preisen in den USA im Zeitraum 1947-1988. Der Unterschied zwischen direkten Preisen und Marktpreisen liegt bei 15%, der zwischen Produktionspreisen und direkten Preisen bei 13%, und der zwischen Produktionspreisen (bei konstanter Profitrate)und Marktpreisen bei 15%. Dass die Marktpreise dieselbe Distanz zu den Produktionspreise wie zu den direkten Preisen aufweisen, erscheint merkwürdig, wenn man die klassische Hierarchie direkte Preise - Produktionspreise - Marktpreise annimmt. Da aber die Produktionspreise mit wechselnder Profitrate fluktuieren, sind obige Zahlen zu relativieren. Shaikh geht davon aus, dass es sich bei Sraffas Standardpreisem um integrierte Versionen von Marxens transformierten Werten handelt. Letztendich seien die Differenzen zischen den verschiedenen Preisformen gering, so dass sie sich auf einem aggregierten Level angleichen würden. Produktionspreise, die aus der Verteilung des Mehrwerts entstehen, erzeugen in monetären Terms ein aggregiertes marginales Kapital, da gleich der Profitrate an jedem Schaltpunkt ist.
Shaikh stellt auch die Analyse der Finance untere arbeitswerttheoretische Gesichtspunkte. Dabei geht erdavon aus, dass die Zinsrate der Preis der Finance ist. Finanzunternehmen operieren profitorientiert, wobei die Konkurrenz die Profitrate der regulierenden Finanzunternehmen um die allgemeine Profitrate (aller Branchen) kreisen lässt. Aus dieser Sicht ist die kompetitive Zinsrate für die Finanzunternehmen wie jeder andere kompetitive Preis mit der allgemeinen Profitrate verlinkt. Für finanzielle und nicht-finanzielle Unternehmen gilt die Zinsrate als die Benchmark für ein Investment. Marx und Keynes gehen davon aus, dass das Investment von der Differenz zwischen Profitrate und Zinsrate abhängig ist. Dabei muss die Zinsrate generell niedriger als die Profitrate sein, wenn der Kredit realisiert werden soll. Shaikh definiert die Profitrate einer Bank als die Rate zwischen dem Profit (Differenz zwischen Zinseinnahmen und den Kosten der Operation) und dem Kapitalstock (Summe der Reserven und fixes Kapital). Die Angleichung des Profits der Bank an die allgemeine Profitrate impliziert, dass jede für gewünschte Reserven-Einlagen-Rate und Einlagen-Kredit-Rate die Zinsrate durch zwei Aspekte determiniert wird: Die allgemeine Profitrate und der Preislevel, der sich auf die Kosten der Inputs (Computer, Gebäude, Büroflächen, Arbeitszeit etc. ) bezieht. Kredite mit längerer Laufzeit beinhalten größere Risiken und benötigen daher höhere Reserven und Depositen-Kredit-Raten, sodass die Zinsrate in diesem Fall höher sein muss, um die allgemeine Profitrate zu realisieren. Die Zinsrate wird zwar kurzfristig durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage determinert, aber langfristig sind es strukturelle Faktoren.
Shaikh geht von einem Ausgleich der Profitrate auch bei den Aktienpreisen aus, i.e. den Ausgleich der realen Gewinnrate der Aktien (Summe der Rate des Anstiegs der realen Aktienpreise und dem Dividendengewinn) mit der realen inkrementellen Rate des Profits. Dies determiniert den Pfad der realen Akteinpreise in einem dynamischen Kontext. Bei den Bondpreisen gleicht die Arbitrage zwischen den verschiedenen finanziellen Instrumenten die Gewinnraten der Bonds mit den Zinsraten gleicher Laufzeit aus, und da diese geringer als die Profitrate sind, sind auch die Gewinnraten der Bonds niedriger als die algemeine Profitate. Und da die Gewinnraten der Aktienpreise geich der Profitrate (inkrementelle) sind, sind die Gewinnraten der Bonds niedriger als die der Aktien. Empirische Untersuchungen bestätigen laut Shaikh die Thesen. Vor allem die Ko-Bewegung zwischen der Gewinnrate der Aktien und der inkrementellen Profitrate der Unternehmen ist für Shaikh ein Beleg dafür, dass bspw. Shillers Behauptung, dass die Aktienpreise aufgrund der irrationalen Erwartungen der Investoren extrem volatil seien, Nonsense ist. Schiller kommt zu dieser Ansicht, weil er das Model der Efficient Market Hypothesis als Benchmark nimmt; dieses geht von der Anahme aus, dass über längere Zeiträume die erwarteten Gewinnraten auf Aktien konstant sind. Weil der aktuelle Aktienmarkt hoch volatil ist,weist jeder Vergleich zwischen ihm und der konstanten Gewinnrate eben auf einen Exzess hin.
Shaikh analysiert schließlich Marxens Position zur Bestimmung der Zinsrate und kommt zum Schluss, dass dieser zwei differente Positionen vertreten habe. Einerseits wird die Zinsrate durch das jeweilige Preislevel und das Verhätnis von Angebot und Nachfrage bestimmt, andererseits geht Marx davon aus, dass auch das finazielle Kapital in die Ausgleichsbewegungen der Profitrate eingeht, und darüber hinaus finanzielle Profite aus der Differenz zwischen den Zinsraten, zu denen Banken Geld leihen, und denen, zu denen sie Geld verleihen, bestehen. Die Neoklassik und Keynes behandeln die Finance als würde es sich hier um nicht-kapitalistische Aktivitäten handeln, die weder der operativen Kosten noch des Kapitals bedürfen. So kann es denn auch keinen Preis der Finance geben, sodass die Zinsrate ausschließlich durch Erwartungen und Präferenzstrukturen bestimmt wird. Keynes bemüht hier die Liquiditätspräferenz, die im IS-LM Apparat von Hicks mündet, der wiederum von der Neoklassik etwas modifiziert wird, um Vollbeschäftigung als Resultat eines allgemeinen Gleichgewichts zu konstruieren. Keysenianer antworteten, dass heute heute die Zentralbank die Zinsrate bestimme.
Foto: Bernhard Weber
Bemerkungen zu Anwar Shaikh`s „Capitalism: Competition, Conflict, Crises“ (3)

Die traditionelle Theorie des internationalen Handels basiert auf zwei grundlegenden Thesen: 1) Der freie Handel wird durch die Theorie der komparativen Kosten geregelt. 2) Er führt zur Vollbeschäftigung in jeder Nation. Die erste These besagt, dass eine Nation vom internationalen Handel profitiert, wenn sie einen Teil der Waren, die mit komparativ niedrigen Kosten produziert wurden, exportiert, und ein gleich gewichtetes Produktionspaket aus dem Ausland importiert. Dabei gleichen sich die Werte der Importe und Exporte aus, i.e. Handeldefizite und -überschüsse werden immer eliminiert, und dies gilt für reiche und arme Länder. Empirisch ist dies natürlich völlig unhaltbar, wenn man bedenkt, dass gegenwärtig große Teile der proletarischen Klasse, die derzeit circa drei Milliarden Menschen weltweit umfasst, arbeitslos sind (weit über eine Milliarde). Zudem sind im heutigen globalen Kapitalismus Handelsungleichgewichte die Regel und nicht die Ausnahme. Keynesianer modifizieren deswegen die Standardpositionen der Theorie der komparativen Kosten, indem sie Oligopole, Skalenerträge, differente Elastizitäten in der Nachfrage, der Technologie und des technologischen Wissens ins Spiel bringen. Dies gibt wiederum der staatlichen Intervention einen gewissen Spielraum. Für Shaikh ist aber das Gründübel der bürgerlichen Theorie schon in Ricardos Theorie der komparativen Kosten angelegt. Im realen Wettbewerb innerhalb einer Nation versuchen die Firmen nämlich die Kosten und die Preise zu senken, um ihre Konkurrenten zu schlagen. Firmen mit niedrigen Kosten erscheinen als Gewinner, Firmen mit hohen Kosten als Verlierer. Smith und Ricardo stimmen dem zu, wobei Ricardo darüber hinaus zu zeigen versucht, wie bestimmte internationale Handelsmuster entstehen, wenn profitsuchende Einzelkapitale in verschiedenen Ländern operieren.
Das Ricardo Beispiel ist bekannt: Verzeichnen die Einzelkapitale in Portugal niedrigere Kosten als die Einzelkapitale Englands (bei allen Waren), so dominieren sie beide Märkte. Da nun Geld von England nach Portugal fließt, steigen in Portugal die Kosten und Preise, umgekehrt in England. Schließlich wird das portugiesische Einzelkapital mit der Ware, die den geringsten Kostenvorteil gegenüber dem Mitkonkurrenten in England besitzt, von der Gewinn- auf die Verlustseite fallen. Umgekehrt in England, dort wird das Einzelkapital mit dem geringsten Kostennachteil auf die Gewinnerseite wandern. Dieser Prozess wird sich sukzessive fortsetzen, bis er eine gewisse Balance erreicht, das heißt die portugiesischen Einzelkapitale werden sich auf die Produktion von Waren konzentrieren, bei denen sie komporative Kostenvorteile besitzen, die sie - für die gleichen Beträge - mit Waren austauschen, die in England komporative Kostenvorteile erzielen. Ricardos Verschmelzung von Handelsgleichgewicht und Gleichgewicht der Zahlungen ist hier wichtig. Die Zahlungsbilanz eines Landes enthält die in ein Land fließenden Nettobeträge, Exporte minus Importe, Direktinvestionen von Ausländern im eigenen Land minus die der inländischen Firmen im Ausland, kurzfristige Kapitalzuflüsse, bspw. Bonds, die von ausländischen Investoren erworben werden minus den Bondkäufen von einheimischen Investoren im Ausland etc. Ricardo geht paradoxerweise davon aus, dass die Handelsströme der Waren von den finanziellen Strömen getrennt sind, wobei eine ausgeglichene Handelsbilanz identisch mit einer ausgeglichenen Zahlungsbiilanz ist. Das ist deswegen möglich, weil das Geld nur als Zirkuationsmittel erscheint, niemals als finanzielles Kapital. Und dies ist seltsam, da die Exporte und Importe von finanziellem Kapital qua Kredit intrinsisch mit dem Export und Import von Waren verbunden sind. Der Handel mit Waren ist bei Ricardo also komplett von den Geldkapitalströmen getrennt, was Marx hinreichend kritisiert hat.
Shaikh schreibt auch an dieser Stelle eine andere Ökono-Fiction. In der Theorie der realen Konkurrenz ist der Preisführer bzw. das regulierende Einzelkapital in jeder Branche dasjenige mit den niedrigsten Stückkosten (Kosten als die Summe der Ausgaben für Material, Löhnen und Abschreibung). Verschiebungen in den relativen Preisen von Waren führen zu Veränderungen der relativen Kosten dieser Waren. Das ist die logische Konsequenz aus Sraffas Annahme, dass Kosten und Preise mit einander verschlungen sind. Bei allen möglichen realen Veränderungen der Tauschraten müssen die komparativen Kosten sich überhaupt nicht ändern, sodass bspw. die stärksten Einzelkapitale in allen Industrien Portugals Preisführer bleiben können und die englischen Einzelkapitale eliminieren. Absolute Kostenvorteile werden also nicht durch Effekte bei den realen Austauschraten gekippt, ja die komparativen Kosten können sich sogar dahingehend entwickeln, dass die Vorteile der Einzelkapitale Portugals gegenübder denen Englands noch größer werden. Solange die realen Kosten (Reallöhne und Produktivität) auf nationalem Level determiniert werden, werden sich die komparativen Kosten nicht in die Richtung bewegen, die Ricardo angenommen hat. Die Bewegung der komparativen Kosten (lineare Funktion der internatioanlen relativen Preise) wird letztendlich durch die relativen Strukturen der Produktion determiniert, das heißt, die internationale Wettbewerbsfähigkeit bleibt an Effizienz, Reallöhne und technische Proportionen der Einzelkapitale gebunden, und es gibt nichts am freien Handel, das absolute Kostenvorteile und -nachteile für bestimmte Einzelkapitale verhindern könnte.
Wenn Handelsungleichgewichte auftauchen, müssen sich die realen Austauschraten nicht verändern. Marx argumentierte, dass ein Land mit einem Handelsüberschuss eine Zufluss von Liquidität erfährt, der die Zinsrate senkt, während bei einem Land mit Handelsdefizit die Liquidität schrumpft und die Zinsrate sich erhöht; dies sind die normalen Funktionen der Kapitalmärkte. Im internationalen realen Wettbewerb haben die regulierenden Kapitale die niedrigsten integrierten Arbeitskosten pro Einheit. Wenn ein Land Waren exportiert, die mit den niedrigsten Kosten hergestellt wurden, dann hängen die Terms of Trade von der Rate der real ingetrierten Kosten der exportierten Güter im Verhältnis zu denen der Produzenten ab, von denen sie Importe erhalten. Die Terms of Trade werden durch nationale Reallöhne und Kostenstrukturen bestimmt, sodass sie sich nicht automatisch in die von Ricardo angenommene Richtung bewegen. Für Shaikh werden schließlich die Terms of Trade und die komparativen Kosten duch die relativen Reallöhne, die relative Produktivität der regulierenden Kapitale und die Effekte der gehandelten und nicht gehandelten Güter bestimmt. Die Richtung der Handelsbewegung einer Nation wird also durch seine absoluten Kostenvorteile determiniert, während die Größe auch durch die relativen nationalen Einkommen bestimmt wird. Letzteres kann den Handel beeinflussen, aber die Kosten nicht radikal verändern. Handelsungleichgewichte führen zwangsläufig zu Zahlungsungleichgewichten, die die Zinsrate affizieren und kurzfristig internationale Kapitalflüsse induzieren: Lander mit absoluten Kostenvorteilen werden ihre Handelsüberschüsse über fremde Kreditvergaben recyceln, während Länder mit Defiziten auf Kreditaufnahmen angewiesen sind.
Im dritten Teil seines Buches untersucht Shaikh die turbulenten Dynamiken in der Makroökonomie. Im realen Wettbewerb werden die Firmen mit abwärts verlaufenden Nachfragekurven konfrontiert, sie setzen Preise und haben differente Kosten und teilen sich in Preisführer und -folger auf. Geld ist endogen und nicht neutral, und die aggregierte Nachfrage und das aggregierte Angebot basieren auf der Profitabilität. Auf einem aggregierten Level kann der ex ante Nachfrageüberschuss folgendermaßen angeschrieben werden:
ED=D-Y= ((C+I)-(Y-T)+(G-T))+(EX-IM)=(I-S)+(G-T)+(EX-IM)
wobei D für die aggregierte Nachfrage für einheimische Güter steht, und dies ist gleich der Summe der Konsumtion (C), des Investments in fixes Kapital und Equipment (I), Staatsausgaben (G) und Export (EX). T steht für die die totalen Steuern von Haushalten und Unternehmen, Y= das nationale Angebot (incl. Importe (IM). Im allgemeinsten Fall wird der Nachfrageüberhang auf die Gleichheit von Ersparnissen und Investition reduziert: ED: I-S
Wenn umgekehrt ein Angebotsüberschuss durch die Räumung des Bestands der Firmen reduziert wird, dann kann man die entsprechende ex post Identität in der Volkswirtchaftlichen Gesamtrechnung dadurch herleiten, dass man die ungeplanten Veränderungen des Bestandes ΔINVu für den Nachfrageüberhang ED substituiert, um dann fogendes zu erhalten: ((I+ΔInVu)-S)+(G-T)+(EX-IM)=0
ED kann gleich Null sein, kann aber auch negative oder positive Werte annehmen: (I-S)+(G-T)+(EX-IM) ≠ Null. Die Neoklassik verspricht hingegen instantanes und kontinuierliches Gleichgewicht: Ed(I-S). Während das Investment eine Nachfrage für verleihbare Geldmittel hervorbringt, stellen die Ersparnisse die Geldmittel bereit, und beide antworten auf die reale Zinsrate. Das Gleichgewicht am Markt für verleihbare Geldmittel sorgt dafür, dass I=S ist und ED=0. Es wird ein Output produziert, der zur Vollbeschäftigung und zur entsprechenden Nachfrage führt, um das Angebot zu konsumieren.
Keynes hingegen widerspricht der Behauptung, dass der Reallohn der Vollbeschäftigung entspricht und dass die reale Zinsrate automatisch zu einer entsprechenden aggregierten Nachfrage führt. Für Keynes stellt sich hingegend die Bewegung folgendermaßen dar: Firmen müssen investieren und der einzige Beweggrund ist die Realisierung einer bestimmten Profitrate (Erwartungen auf die Profitrate, die volatil ist), die mit der erwarteten Nachfrage korreliert ist. Umgekehrt korreliert die aggregierte Nachfrage der Haushalte mit den aktuellen Einkommen. Es gibt keine Garantie, dass die aggrgrierte Nachfrage der Haushalte mit der erwarteten Nachfrage der Firmen identisch ist, sodass eben Ungleichgewicht der normale Zustand ist. Da Keynes das Investment zumindest kurzfristig für stabil hält, müssen über die Ersparnisse die notwendigen Angleichungen vollzogen werden, um zum Gleichgewicht zu gelangen. Ersparnisse sind der Teil des Einkommens, der nicht konsumiert wird, und die Konsumtion ist wiederum abhängig vom Einkommen, das in der Produktion erzeugt wird. Am Ende muss die Produktion und damit die Beschäftigung dafür sorgen, dass die Ersparnisse gleich der Investition sind. Das ist Keynes` Antwort auf das Say`sche Gesetz. Keyes nimmt an, dass die Erparnisse ein stabiler Teil des Einkommens sind. Wenn das Investment um 100 ansteigt und die Ersparnisse ein Fünftel des Einkommens ausmachen, dann muss der Output 500 sein, damit die Rendite auf Ersparnisse gleich dem Investment ist. Das ist der Keynes´sche Multiplikator. Ein Anstieg der Rendite auf Ersparnisse lässt nun die Ersparnisse über das Investment steigen, sodass der Output und die Beschäftigung fallen müssen, damit es wieder zu einem Gleichgewicht zwischen Investment und Ersparnissen kommt. Dies gilt allerdings nur für das kurzfristige Investment. Keynes bestimmt wie Marx die erwartete Nettoprofitabilität als die Differenz zwischen der erwarteten Profitrate (die marginale Effizienz des Investments) und der Zinsrate. Ein Sinken der Beschäftigung dämpft die Gewinnerwartungen und steigert die Zinsrate aufgrund wachsender Risiken, sodass das Investment weiter fällt. Keyes war sich zwar klar, dass ein Fall der Reallöhne die Profitrate erhöhen würde, aber ein Sinken der Nachfrage würde zu einem weiteren Fall der Preise führen und die Reallöhne wieder erhöhen, aber am Ende die Profiterwartungen weiter dämpfen.
Keynes fokussiert sich auf komparative Statik, sodass der Zeitbezug an dieser Stelle weitgehend wegfällt. Die Zinsrate wird durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage nach Geld bestimmt. Während das Geldangebot vom Staat bestimmt wird, hängt die Nachfrage nach Geld von den Einkommen ab und die Zinsrate gilt als eine Belohnung auf das Halten des Geldes, das vielleicht später investiert wird. All dies erfordert wiederum das Vertrauen auf die Zukunft, wobei ein Vertrauensverlust in der Krise zum Abzug aus finanziellen Titeln hin zum Cash und zu einem Anstieg der Zinsrate führt, und das gerade dann, wenn eine Senkung benötigt wird, sodass es schließlich effektiver ist, wenn der Staat durch deficit spending in der Krise für die aggregierte Nachfrage sorgt.
Die Annahmen von Keynes wurden schnell in das IS-LM Modell von Hicks integriert. Für Keynes wird der Gleichgewichts-Output durch das Investment und den Multiplikator (IS) determiniert, und das Investment hängt vom Exzess der volatilen, erwarteten Profitrate über die Zinsrate ab. Hicks eliminiert nun die erwartete Profitrate, sodass das Investment zu einer simplen passiven Funktion der Zinsrate mutiert. Was aber, wenn wie in der gegenwärtigen Krise sichtbar, eine niedrige Zinsrate nicht zu neuen Investitionen führt? Hicks Behandlung der Geldnachfrage (LM) grenzt wiederum die Volatilität aus, sodass sie eine stabile positive Funktion des gegenwärtigen Einkommens und eine negative Funktion der Zinsrate wird (eine höhere Zinsrate für finanzielle Assets veranlasst Investoren dazu, weniger Cash zu halten). Das IS-LM-Gleichgewicht erfordert eine spezifische Kombínation zwischen Einkommen (Output) und Zinsrate. Über die Intervention des Staates und den Export soll die Nachfrage gesteigert werden, i.e. eine expansionistische Fiskalpolitik soll das Gleichgewichtslevel des Outputs erhöhen. Und eine expansionistische Geldpolitik soll das Geldangebot erhöhen und die LM-Kurve verschieben, das heißt den Output erhöhen, aber die Zinsrate senken, sodass der Staat mittes seiner Fiskal- und Geldpolitik immer Vollbeschäftigung erzielen kann, ohne dass sich Zinsrate und Preislevel verändern. Das Preislevel steigt dann nur, wenn die aggregierte Nachfrage den Output bei voller Beschäftigung übersteigt. Joan Robinson hat vermutet, dass die Preise schon vor dem kritischen Punkt seigen und deswegen hat man im Keynesianismus eine Inflation-Unterbeschäftigung Kurve (Philipps) eingeführt, bei der es eine negative Korrelation zwischen Inflation und Unterbeschäftigung gibt, was allerdings hinfällig wurde, als wir es Anfang der 1980er Jahre mit dem Phänomen der Stagflation zu tun bekamen.
Foto: Bernhard Weber
Marxism as Anti-Philosophy: An Interview with Dario Cankovic

The production of ideas, of conceptions, of consciousness, is at first directly interwoven with the material activity and the material intercourse of men, the language of real life. Conceiving, thinking, the mental intercourse of men, appear at this stage as the direct efflux of their material behaviour. The same applies to mental production as expressed in the language of politics, laws, morality, religion, metaphysics, etc., of a people. Men are the producers of their conceptions, ideas, etc. – real, active men, as they are conditioned by a definite development of their productive forces and of the intercourse corresponding to these, up to its furthest forms. Consciousness can never be anything else than conscious existence, and the existence of men is their actual life-process. If in all ideology men and their circumstances appear upside-down as in a camera obscura, this phenomenon arises just as much from their historical life-process as the inversion of objects on the retina does from their physical life-process. In direct contrast to German philosophy which descends from heaven to earth, here we ascend from earth to heaven. That is to say, we do not set out from what men say, imagine, conceive, nor from men as narrated, thought of, imagined, conceived, in order to arrive at men in the flesh. We set out from real, active men, and on the basis of their real life-process we demonstrate the development of the ideological reflexes and echoes of this life-process. The phantoms formed in the human brain are also, necessarily, sublimates of their material life-process, which is empirically verifiable and bound to material premises. Morality, religion, metaphysics, all the rest of ideology and their corresponding forms of consciousness, thus no longer retain the semblance of independence. They have no history, no development; but men, developing their material production and their material intercourse, alter, along with this their real existence, their thinking and the products of their thinking. Life is not determined by consciousness, but consciousness by life. In the first method of approach the starting-point is consciousness taken as the living individual; in the second method, which conforms to real life, it is the real living individuals themselves, and consciousness is considered solely as their consciousness. This method of approach is not devoid of premises. It starts out from the real premises and does not abandon them for a moment. Its premises are men, not in any fantastic isolation and rigidity, but in their actual, empirically perceptible process of development under definite conditions. As soon as this active life-process is described, history ceases to be a collection of dead facts as it is with the empiricists (themselves still abstract), or an imagined activity of imagined subjects, as with the idealists. Where speculation ends – in real life – there real, positive science begins: the representation of the practical activity, of the practical process of development of men. Empty talk about consciousness ceases, and real knowledge has to take its place. When reality is depicted, philosophy as an independent branch of knowledge loses its medium of existence. At the best its place can only be taken by a summing-up of the most general results, abstractions which arise from the observation of the historical development of men. Viewed apart from real history, these abstractions have in themselves no value whatsoever. They can only serve to facilitate the arrangement of historical material, to indicate the sequence of its separate strata. But they by no means afford a recipe or schema, as does philosophy, for neatly trimming the epochs of history. On the contrary, our difficulties begin only when we set about the observation and the arrangement – the real depiction – of our historical material, whether of a past epoch or of the present. The removal of these difficulties is governed by premises which it is quite impossible to state here, but which only the study of the actual life-process and the activity of the individuals of each epoch will make evident. We shall select here some of these abstractions, which we use in contradistinction to the ideologists, and shall illustrate them by historical examples.Even if other philosophers pay lip service to practice, Marx takes it seriously, and goes on to attempt to develop an account of how theory emerges out our practice, the abstract emerges out of the concrete, language out of life, ideas out of matter. Materialism and idealism are indeed metaphysical stances, but insofar as Marx overcomes the antinomy between the two and offers us a new historical understanding of matter, Marx overcomes metaphysics. He thus establishes the foundations for a scientific understanding of phenomena previously relegated to the domain of philosophy. Historical materialism is not a metaphysical but a methodological stance. It is the methodology of a science without metaphysics. This doesn’t mean science without a priori or analytic elements, but rather it permits for a scientific understanding of the a priori and analytic. Unlike philosophers who make pronouncements about what the world is or must be like from the armchair, historical materialists should recognize that there is no royal road to nor through science. If you want to know what the world is like there is no other way than through scientific investigation. I suppose if I were to try and answer what ontology should historical materialists accept, I would say that of the best sciences of the day. This doesn’t mean blind submission to whatever scientists say. Science itself is a social activity and a product of bourgeois society. Insofar as historical materialist exposes ideological and material conditions which shape and distorts scientific investigation and findings, it makes a better science possible. C.D.V.: Are you putting Marx in counter distinction to Engels who did have a commitment to dialectical oppositions in physics? The issue I have here is by looking at Engels and many other of the early Marxists writings on science, the dialectic is transcendentally assumed. As such, the method itself either results in metaphysical implications, or are you implying that the earliest historical materialists did not understand Marx’s scientific views? D.C.: Indeed, I do think Marx and Engels part ways on this point. Insofar as many early Marxists follow Engels and accept an Engelsian dialectics of nature — which does have a metaphysical or transcendental status — early Marxists misunderstood Marx. Or, at least, they underestimate the radical import of historical materialism. They treat Marx as yet another philosopher who just happens to have stumbled onto the right theory, as opposed to all those previous philosophies which were wrong. In contrast, if I’m right about the radical import of historical materialism, it isn’t just another new philosophy, but rather represents a radical break with philosophy itself because it overcomes the antinomies, the contradictions, between the concepts and categories — subject and object, mind and matter, particular and universal, practical and theoretical, etc. — upon which all philosophical debates are based. Insofar as historical materialism allows us to scientifically investigate and explain our concepts and categories, how they emerge out of concrete conditions, the very activity of philosophizing, and how the social being of philosophers determines their consciousness, it renders philosophy obsolete. Philosophy stands to historical materialism as astrology does to astrophysics. In fact, Marx himself might not have fully realized the implications of historical materialism. He was, after all, a prolific writer, activist, polemicist, political economist, philosopher, social scientist. Insofar as Marx himself had a tendency to jump from project to project and left unfinished even his magnum opus, Capital, we don’t know where he was going or where his ideas will lead us. The task for present-day Marxists remains to finish Marx’s projects: the methodological project of realizing “scientific socialism,” that self-conscious science in the service of emancipation; the theoretical project of understanding the capitalist mode of production; and, lastly and more importantly, the practical political project of changing the world. C.D.V.: This is similar, on this point, to some analytical Marxists and anti-dialectical Marxists. Do you still see the dialectical form as important to the logic of Marxism? D.C.: Like before, much here depends on what we mean by the term “dialectics.” Insofar as “dialectics” has far too much pre-Hegelian and Hegelian baggage I’d rather dispense with it entirely. That being said, I suppose if you want to understand dialectics as dynamics, the study of motion, then not only is “the dialectical form” important to Marxism, it is essential to Marxism. Historical materialism provides the foundations for a scientific understanding of the dynamics of history. Marxists didn’t used to shy away from the natural and formal sciences of their day; we shouldn’t shy away from them either. Contemporary Marxists have a lot to learn from the developments in dynamical systems theory if they want to understand capitalism, as capitalism is, after all, a complex dynamical system. Not only that, but if we aspire to abolish the anarchy of the market and replace it instead with rational planning we’d damn well better be familiar with information theory, mathematical optimization, systems engineering, operations research, and countless other fields. Science hasn’t remained static, though the understanding of Marxists of it seems to have — which isn’t surprising when many Marxist remnants are housed in humanities departments and have reduced Marxism to literary criticism. Scientific socialism demands taking science seriously. It shouldn’t come as a surprise that while the bourgeoisie in the United States depoliticized the sciences — formal, natural and social — during the Cold War, they left the humanities largely unmolested. The bourgeoisie have proven themselves to have good class instincts. I suspect this is partly because the humanities are largely harmless. They can only interpret the world in various ways — they can’t understand it, and consequently they can’t change it. C.D.V.: How do Marxists avoid the technocratic liberalism that exists in most of the applied scientific work out there? D.C.: Scientific socialism needn’t just be socialism in the spirit of science, but also can be conceived of as science in the service of socialism. Environmental groups already fund their own studies to counter corporate propaganda. Socialists, if we got ourselves organized and managed to recreate a mass movement, could do similar things. We should be training scientists and recruiting scientific workers into our ranks. There has been an increasing proletarization of the intellectual workforce. Socialists should capitalize on this. Scientists have historically been quite sympathetic to socialism, because socialism was once not just sympathetic to but a strong proponent of science. It can be so again. Another way to avoid and combat this “technocratic liberalism” is by articulating the emancipatory potential of science and technology. Increases in productivity could increase leisure, but instead under capitalism they are put in the service of profits. Humanity is made to serve the technology that is creates, the physical capital, in the name of profit, instead of it serving humanity. The Internet, a potentially radically democratic tool is instead made to service capital. Its potential to render politics transparent and politicians accountable is instead turned around and used for massive surveillance by the state and the market in the name of, respectively, security and profits. Many, though by no means all, technologies developed by the bourgeoisie are “dual-use,” so to speak. They are put in the service of profits and exploitation but could be turned to serve the people and emancipation. Socialists today could stand to learn a thing or two not just from science but from science fiction. In an age where the technology that we have is beyond the wildest dreams of previous science fiction writers, most of who couldn’t even imagine computers or a world-wide information network, socialists need to dream — to dream big, and to dream big publicly. Where News from Nowhere or Looking Backward were once sheer fantasy, today the sorts of utopias they envision are realizable and as such outdated, because they do not adequately represent the emancipatory potential of present and future technology. I find it somewhat curious that at a moment in history where socialism would be easier to build than ever, at least objectively, many socialists can do nothing but look to the past and lick their wounds, rather than peer into the future toward that communist horizon. We need to stop weighing ourselves down by traditions of dead generations and instead draw our poetry from the future. C.D.V.: Anything you’d like to say in closing? D.C.: Thanks you for the interview. It has helped me work through some of these ideas more fully, and I hope that it stimulates further desperately needed discussion on the subject of science and socialism. Insofar as a scientific spirit is antithetical to sectarianism, putting science back into scientific socialism might go some way toward undoing the sectarianism and dogmatism that has plagued 20th-century socialism. Taken from The North Star Foto: Bernhard Weber
Superpositions

“Husserl needed the science of psychology as a waypoint toward the autonomy of the transcendental, Kant needed newtonian physics as passage toward the a priori and the transcendental, Heidegger needed ontological difference to get to Ereignis, Plato needed mathematics to get to philosophy. Today we need quantum physics and particularly its use of imaginary numbers in order to pass on to the generic.” (Philosophie non-standard, 257–58)Laruelle has thus not anointed quantum mechanics as some sort of special meta-discourse able to speak in the voice of being. Rather, quantum theory is merely a particularly convenient way to obtain a generic science, in part because quantum theory already speaks the language of the generic (via concepts like non-commutativity or superposition). Still, quantum theory remains just as “philosophical” as philosophy itself, and thus requires its own non-standard parallel (the task of a book like Philosophie non-standard). In other words, Laruelle is rejecting the typical way in which people talk about quantum mechanics, that it's a “weird” physics disrupting common sense conceptions of “the real world.” Laruelle is saying the opposite: it's our world around us, the standard world, that's weird and fake:
“Unlike the quantum theory of matter, which supposes a macroscopic world in-itself and runs up against antinomies or exclusions once it broaches the microscopic . . . , the quantum theory of philosophy supposes that the world in-itself of philosophy is posited as symptom or objective appearance.” (Anti-Badiou, 120-121)Quantum mechanics is simply a generic forcing of classical mechanics. Thus it's no surprise that quantum mechanics has given us the framework of generic immanence. Non-philosophy shows us the same framework. In other words, quantum mechanics must be recategorized as a sub-discipline (before the fact, of course) of non-philosophy. And, by contrast, classical mechanics is equivalent to philosophy since both are world-bound modes of thought governed by the transcendental. taken from here
THE PROFIT RATE IN THE PRESENCE OF FINANCIAL MARKETS: A NECESSARY CORRECTION

Bemerkungen zu Anwar Shaikh`s „Capitalism: Competition, Conflict, Crises“ (4)

Ein Kapitel widmet Shaikh dem postkeynesianischen Ökonom Michal Kalecki. (Kalecki lässt sich der europäischen Gruppe von Postkeynesianern um Robinson, Kaldor, Kahn und Harcourt zurechnen, die von Sraffa kommend sich wenig um die Finanzökonomie kümmern.) Kalecki geht wie Keynes davon aus, dass das Investment kurzfristig gegeben ist, aber langfristig auf die Differenz zwischen der zukünftigen Profitrate und der Zinsrate reagiert. Ein gegebenes Niveau der Profitrate impliziert ein bestimmtes Investment. Die Zinsrate wird durch monetäre Faktoren und die Profitrate durch die Kapazitätsauslastung und die Höhe der Löhne determiniert. Kalecki fügt in seiner späten Phase noch eine Art Klassenanalyse hinzu, indem er das totale Einkommen in das von Kapitalisten und Arbeitern teilt und davon ausgeht, dass beide eine fixe (marginale) Neigung zum Sparen besitzen. Der Multiplikator ist derselbe wie bei Keynes, jedoch ist die Sparneigung vom Verhältnis der Löhne zu den Profiten abhängig, die wiederum durch monopolistische Gewinnaufschläge gekennzeichnet sind und von den Firmen zu ihren primären Kosten hinzuaddiert werden. Inflation basiert auf Reallohnerhöhungen. In seiner frühen Phase geht Kalecki noch davon aus, dass die Reallöhne und der Lohnanteil weder durch Klassenkämpfe noch durch die Arbeitslosenrate beeinflusst werden können, während er in seiner späten Phase behauptet, dass die Kämpfe der Arbeiter zu einer Senkung der Gewinnaufschläge führen können, während im Fall einer Senkung der Arbeitslosenquote höhere Reallöhne in Aussicht stehen.
Wie Keynes widerspricht Kalecki der Auffassung, dass ein Anstieg der Reallöhne per se die Profitabilität senkt und die Arbeitslosigkeit steigert, da der Anstieg der Reallöhne zwei sich widersprechende Effekte auf die aktuelle Profitrate besitzt: Er verringert die normale Profitrate, aber er erhöht auch die Kapazitätsauslastung der Unternehmen, wenn eben die effektive Nachfrage der Arbeiter steigt. Dabei gehen die Keynesianer davon aus, dass der Effekt einer Erhöhung der Nachfrage größer als beim Fall der Profitrate ist, wobei es jedoch Shaikh zufolge anzumerken gilt, dass die Etablierung der Kapazitätsauslastung auf einem niedrigeren Niveau der Profitrate zu einer Senkung des Wachstums führt. Die Kapazitätsauslastung erhält den Status einer freien Variable, und dies heißt, dass Überschusskapazitäten niemals vollkommen eliminiert werden können, was wiederum mikroökonomisch keinen Sinn ergibt. Für die Keynesianer ist eines klar: Die Fiskalpolitik kann dann den Output und die Beschäftigung erhöhen, während die Geldpolitik den Druck auf die Zinsrate abschwächt.
Generell folgt der Postkeynesianismus folgenden Thesen: Die aggregierte Nachfrage bestimmt den Output, das Geld wird endogen durch das Bankensystem kreiert und der Staat kann Vollbeschäftigung bei einem entsprechenden Niveau der Inflation herstellen. Wenn die Nachfrage den Output treibt, dann heißt dies für das Investment, dass es unabhängig vom Angebot der privaten Ersparnisse bleibt, sodass es allein durch Bankkredite finanziert wird. Die existierenden Ersparnisse bilden damit kein Hindernis für die Investitionen. Hinsichtlich des Multiplikators muss das Wachstum der Investitionen ein bestimmtes Wachstum des Outputs nach sich ziehen, wobei es unter Umständen zur Ponzi Finanzierung für neues Investment kommt. Dass die Ersparnisse mit den Erfordernissen der Finanzierung des Investments nicht verlinkt sind, erscheint empirisch unhaltbar. Folgendes gilt es weiter zu beachten: Wenn das Investment von der Differenz der erwarteten Profitrate zur Zinsrate abhängig ist, dann impliziert ein gegebenes Level der Profitrate ein bestimmtes Investment. Beim Multiplikator führt ein bestimmtes Level des Investments zu einem bestimmten Level des Outputs. Wenn das Investment steigt, dann steigt auch der Kapitalstock, sodass auch die Kapazität steigen muss. Die Kapazitätsauslastung (Rate zwischen Output und Kapazität) muss dann fallen. Die traditionelle Multiplikatortheorie ist hinsichtlich des Bestand-Fluss-Problems inkonsistent. Man kann sich damit helfen, dass man die Akkumulationsrate (Verhältnis von Investition zu Kapital) auf die erwartete Nettoprofitrate bezieht, aber die daraus resultierende Rate der Kapazitätsauslastung wird gegenüber der normalen Rate pendeln. Wenn man hingegen davon ausgeht, dass die Akkumulation der normalen Kapazitätsauslastung entspricht, dann wird die Akkumulationsrate von der Ersparnisrate beeinfusst. Das Problem löst sich auf, wenn man die Annahme aufgibt, dass die Ersparnisse der Unternehmen unabhängig von den Investitionen sind.
Es lassen sich bei Keynes laut Shaikh eine Reihe weiterer Widersprüche finden. Während Keynes einerseits behauptet, dass das Geldangebot durch die staatlichen Autoritäten reguliert würde, sagt er andererseits, dass die Differenz zwischen den Ersparnissen und dem Investment durch Bankkredite geschlossen werden könne (bei jeder gegebenen Zinsrate), womit das Geldangebot direkt von der Nachfrage nach Kredit abhinge. Damit würde Keynes korrekterweise von der Endogenität des Geldes ausgehen. Und dies wiederum kollidiert mit seiner LM-Funktion, weil die Liquiditätspräferenz dann die Zinsrate determiniert, da das Geld endogen ist.
Ein Postkeynesianer, der wie etwa Minsky sich stärker um die Finanzökonomie kümmert, ist Paul Davidson. Dieser führt folgende grundlegende Theoreme aus. 1) Die Nachfrage ist kurzfristig aufgrund der Möglichkeit von Konsumentenkrediten als autonom einzuschätzen, allerdings bleibt die Investition die wichtige autonome und paradigmatische Variable, die auf dem Nettogewinn basiert. 2) Die Kapitalökonomie wird vom Geld getrieben. Unternehmen investieren Geld in Material, Arbeitskräfte und Maschinen, um Mehr Geld zu erzielen, wobei der gesamte Prozess in Form Geldverträgen für gegenwärtige und zukünftige Lieferungen überbrückt und angeleitet wird. Diese Ausführungen kommen Marxens Kreislauf G-W-G` nahe. 3) Geld ist endogen, insofern es vom Kredit getrieben wird und reale Effekte auf die Produktion, Wachstum und Beschäftigung hat. 4) Es gibt keine Garantie dafür, dass erwartete ökonomische Ereignisse sich auch realisieren, da die Zukunft grundlegend unsicher ist. Unsicherheit impliziert, dass es viele unvorhersehbare Ereignisse gibt, denen keine Wahrscheinlichkeiten zugeordnet werden können. Risikotheorie kann deshalb nicht auf Wahrscheinlichkeitstheorie basieren. Bei der neoklassischen Theorie der rationalen Wahrscheinlichkeit hingegen muss die Zukunft ergodisch sein (durchschnittliche Zukünfte sind gleich durchschnittlichen Vergangenheiten) und die subjektive Verteilung der zukünftigen Ereignisse muss gleich der objektiven sein. Wegen der fundamentalen Unsicherheit der Zukunft sind liquide Assets wichtig und die Nachfrage nach Liquidität steigt, wenn die Angst vor einer unsicheren Zukunft steigt. (Liquidität definieren wir als die nominale Relation zwischen Fristigkeit und Wert. Wenn Liquidität Geld bedeutet, das virtuell bzw. latent in einem finanziellen Asset vorhanden ist, so geht das nur, wenn das Asset aktuell sich nicht in der monetären Form befindet. Wenn Liquidität sich aktualisiert bzw. zu Geld transformiert, dann ist damit die Liquidität des Assets liquidiert. Demzufolge kann die Anlage niemals perfekt in ihrer Liquidität bleiben, und in diesem Sinne erscheint Liquidität als die intensive Konsequenz zur extensiven Eigenschaft des Wertpapiers, das im Geld denotiert ist. Somit handelt es sich bei der Liquidität um eine funktionale Relation zwischen einer Zeit der Verzögerung und dem Zeitpunkt der Realisierung des Assets.)
Shaikh bemüht sich natürlich auch um die Rekonstruktion der Makroökonomie durch die klassische Ökonomie, wobei hier der Begriff des realen Wettbewerbs eine zentrale Rolle spielt. Die wichtige These ist, dass die Wachstumsrate des Kapitals durch die erwartete Nettoprofitrate (Differenz der erwarteten Profitrate und Zinsrate) bestimmt wird. Im Gegensatz zum Keynesianismus, bei dem die Profitrate sozusagen in der Luft hängt, ist die erwartete Profitrate an die aktuelle Profitrate und diese bleibt wiederum an Durchschnittsprofitraten gebunden. Im Boom steigt die erwartete Profitrate über die aktuelle Rate, in der Rezession ist es umgekehrt. Beide Raten fluktuieren um einander in einer turbulenten Art und Weise. Wenn die Gewinnrate im finanziellen Sektor größer als im industriellen Sektor ist, dann fließt Kapital mit einer beschleunigten Rate in den finanziellen Sektor. In diesem Prozess affizieren die Erwartungen die aktuellen Preise, diese wiederum die Fundamentaldaten, während die Erwartungen wiederum durch die Bewegungen der aktuellen Preise und der Fundamentaldaten affiziert werden. Die aktuellen Preise oszillieren somit in turbulenter Art und Weise um die gravitationsorientierten Werte. Da die Erwartungen die Fundamentaldaten affizieren können, deswegen müssen die gravitationsorientierten Zentren selbst pfadabhängig sein. Somit ist die Zukunft keine stochastische Reflexion der Vergangenheit, sondern sie ist nicht-ergodisch. Dennoch können die Erwartungen keinerlei Realität erzeugen, die sie selbst nur bestätigt, vielmehr fungieren die gravitationsorientierten Zentren wie etwa die allgemeine Profitrate weiterhin als Regulatoren der aktuellen ökonomischen Ereignisse, sodass Boomphasen in Rezessionen münden, und umgekehrt. Shaikh geht weiterhin davon aus, dass es zwei Unterscheidungen zu beachten gilt, nämlich die zwischen der Durchschnittsprofitrate und derjenigen von neuem Kapital sowie die zwischen der Profitrate von finanziellen Firmen und den Renditeraten auf die finanzielle Spekulation. Der Wettbewerb führt zum turbulenten Ausgleich der Rentabilität bzw. der Renditeraten in allen Bereichen. Dies gilt es allerdings bei der Verzinsung und den Renditen auf Spekulationen zu bezweifeln. Der Zins besitzt keine notwendige Relation zum Profit, außer dass die totalen Nettozinsen niedriger als der Mehrwert sein müssen.
Im Kontext einer wachsenden Ökonomie gilt es dann das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu berücksichtigen. Das Wachstum des Outputs wird nicht von der Nachfrage getrieben, vielmehr wird eine exogene Erhöhung der Nachfrage zu einem Sinken des Wachstums führen (Harrod). Auch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage wird durch die Profitabilität reguliert: Das Produktionsangebot basiert auf Profit, während die Nachfrage bzw. Konsumtion von den Löhnen und der Zinsrate abhängt; die Dividenden sind Teile des Profits und die Nachfrage nach Investitionen wird durch die erwarteten Profite reguliert. Die klassische Makroökonomie, so resümiert Shaikh, sei weder angebots- noch nachfrageorientiert, sondern eben profitorientiert. Weiter sind die Ersparnisse der Unternehmen nicht unabhängig von den Investitionen, weil beide Größen derselben Entität angehören. Wenn die Ersparnis derart ansteigen, dass man mit ihnen jeden Anstieg der Investitionen finanzieren kann, dann gibt es keinen Multiplikator. Jede Ersparnisrate der Unternehmen reagiert auf die Differenz zwischen Investment und aktuellen Ersparnissen. Diese Rate ist endogen.
Beim einfachsten makroökonomischen Modell der Klassik antwortet die Akkumulationsrate (Wachstumsrate des Kapitals) auf die erwartete Nettoprofitrate (erwartete Profitrate minus Zinsrate), und die Ersparnisrate bezieht sich auf die Differenz zwischen Investment und Ersparnissen. Kurzfristig wird die Zinsrate steigen, wenn die finanzielle Differenz positiv ist, aber langfristig wird die finanzielle Situation der Unternehmen mit dem Ausgleich der Profitraten korrelieren und die normale Zinsrate mit dem Preislevel und der normalen Profitrate. Des Weiteren bietet der Bankkredit die Möglichkeit, dass die Ausgaben gegebene Einnahmen übersteigen können. Banken können neue Kaufkraft erzeugen, sodass das Investment schneller als die Ersparnisse steigt, und die Konsumtion schneller als das Einkommen. Für Skaikh bleibt aber die Profitrate der Dreh- und Angelpunkt des Systems, obgleich Banken das Verhältnis von erwarteter und aktueller Profitrate, von Angebot und Nachfrage und von Output und Kapazität beeinflussen können. In einem wachsenden System steigt die nominale Wachstumsrate, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, die Wachstumsrate des Kapitalstocks steigt, wenn der Output die Kapazität übersteigt und das Kapital fließt stärker in den finanziellen Sektor, wenn die aktuelle Zinsrate die normale Zinsrate übersteigt. Dies vollzieht sich stets im Rahmen turbulenter Ausgleichsbewegungen, wobei kurzfristig Angebot und Nachfrage dominiert, langfristig das Verhältnis zwischen Kapazität und Output, zwischen den aktuellen und normalen Zinsraten sowie zwischen den aktuellen und den erwarteten Profitraten. Dies synthetisiert die Bemerkung von Keynes, dass die Nachfrage relativ autonom hinsichtlich der Generierung der Kaufkraft sein könne, mit der klassischen und keynesianischen These, dass die Akkumulation von der Nettoprofitabilität abhängig sei, sowie der klassischen These, dass die erwartete Profitabilität von der normalen Profitabilität abhängig sei und dass die aktuelle Kapazitätsauslastung um die normale Auslastung schwanke. Das Niveau der Ersparnisse und des Investments sind von der Zinsrate und dem Level des Outputs abhängig, wobei die Zinsrate wiederum von der Profitrate determiniert wird, und die Ersparnisrate mit der Investmentrate verlinkt ist. Weil die aktuellen Wachstumsraten um das Gleichgewicht fluktuieren, wird der Level des Outputs einen stochastischen und einen deterministischen Aspekt besitzen, er ist pfadabhängig. Selbst ein temporärer Anstieg der Profitrate wird den Level des Outputs und der Beschäftigung erhöhen. Das ist die klassische Antwort auf Keynes Multiplikator.
Bei der Untersuchung des Verhältnisses von Löhnen, Beschäftigung, Profitabilität und Wachstum kommt Shaikh zu dem Schluss, dass Wettbewerb und flexible Reallöhne immer zu einer bestimmten Arbeitslosenrate führen. Hinsichtlich der Frage der Vollbeschäftigung hat Marx festgestellt, dass man im Kapitalismus je schon eine bestimmte Arbeitslosenrate vorfindet. Goodwin hat das Marx`sche Argument formalisiert, indem er den Reallohn zunächst auf die Produktivität und die normale Arbeitslosenrate bezieht. Das Wachstum der Produktivität und der Beschäftigung öffnen Räume für die Erhöhung des Lohnanteils und der Reallöhne. Wenn die Arbeitslosigkeit unter ein bestimmtes Level fällt, steigt unter Umständen die Kampfkraft der Arbeiter. Daraus folgt, dass die Rate des Wandels der Reallöhne im Verhältnis zur Produktivität eine negative Funktion der Arbeitslosenrate ist. Diese ist wiederum von der Höhe des Outputs, der Produktivität und der Macht der Arbeiter abhängig. Die Wachstumsrate des Outputs ist von der normalen Nettoprofitabilität, die die Akkumulation treibt, abhängig. Da Wachstum der Produktivität und der Beschäftigung korrelieren mit den Lohnstückkosten, wobei deren Anstieg die Bemühungen der Unternehmen forciert, die Produktivität zu erhöhen. Die gegenseitige Beeinflussung des Wachstums von Output und Produktivität ist als Verdoon`s Gesetz bekannt.
Wenn ein stabiler Lohnanteil (ß), der die Stärke der Arbeiterklasse reflektiert, zum nationalen Einkommen ins Verhältnis gesetzt wird (der Nettooutput per Arbeiter (y) ist gleich der Summe der realen Löhne und Profite per Arbeiter), dann erhält man folgende Relation: yt=At x kt hoch 1-ß. Dies sieht nach einer aggregierten Cobb-Douglas Funktion aus, obgleich sie aus der Klassenkampftheorie der Arbeiter in Bezug auf die Reallöhne abgeleitet ist. Langfristig ist der Lohnanteil positiv mit dem ursprünglichen Lohnanteil und der Beschäftigungsrate korreliert, negativ mit der Produktivität und dem Wachstum der Beschäftigten. Eine Erhöhung der aggregierten Nachfrage kann kurzfristig die Beschäftigung und das Wachstum des Outputs erhöhen, aber wird die Arbeitslosigkeit langfristig nicht beseitigen, da es interne Mechanismen gibt, die die Arbeitslosigkeit erneut in Szene setzen. Diese Aussage setzt Shaikh in Beziehung zur Philipps Kurve. Philipps hat die Effekte der Arbeitslosigkeit auf die Löhne untersucht. Seine Antwort bezog sich auf die Veränderung der Geldlöhne und affirmiert weitgehend die Perspektive von Keynes. Shaikh glaubt, dass der Kampf um Reallöhne in Relation zum generellen Level der Produktivität geführt wird, sodass die entsprechende Philipps-Kurve den Wandel der nominalen Löhne im Verhältnis zum Produktivitätswachstum und zur Inflation spiegeln muss. Ein stabiler Reallohn existiert nur dann, wenn das Produktivitätswachstum konstant ist, und eine stabiler Geldlohn, wenn die Inflation konstant ist. Empirische Untersuchungen folgen.
Weitergehend untersucht Shaikh die Ursachen der Inflation unter den Bedingungen des modernen Fiatgeldes. Für Shaikh hat der Staat das Geld nicht erfunden, er hat nur dessen Basis auf einer bestimmten historischen Stufe erweitert, und erst in einem späten historischen Stadium hat er das Geld monopolisiert, das heißt, er hat private Funktionen übernommen, während private Banken weiterhin den Großteil des Geldes als Zirkulations- und Zahlungsmittel kreieren. Zwar übt der Staat eine gewisse Kontrolle über die Banken aus, eine Kontrolle, deren intrinsische Limitationen jedoch bei jeder Finanzkrise deutlich werden. Für Shaikh ist das Fiatgeld (inkonvertibles Zeichengeld) die moderne Form des Geldes. Die Geschichte des Geldes zeigt, dass die private Geldzirkulation das Zeichengeld ermöglicht, sobald ihre Funktion als Geld und zugleich ihre Inkonvertabilität akzeptiert wird. Keynes applaudiert hingegen dem Chartalisten Knapp, der die Macht des Staates und die Passivität der privaten Agenten rühmt, während die Neoklassiker das Geld als die Kreation der privaten Märkte definieren. Keynesianer und Neo-Chartalisten gehen davon aus, dass der Staat Fiatgeld unbegrenzt schöpfen kann und es dabei zu keiner Inflation oder zu einem Anstieg der Zinsrate kommen muss. Das Fiatgeld befreit den Staat zumindest von gewissen Budgetrestriktionen. Es war der Sauerstoff für verschiedene Revolutionen, hat aber auch immer wieder zu Hyperinflationen geführt. So musste der Fiskus der modernen Staaten bestimmte Regelungen einführen, die das direkte Schöpfen von Geld, um etwa Finanzdefizite auszugleichen, verbieten. Der Staat kann Geld nur in einem bestimmten Verhältnis zu seinen Steuereinnahmen und zur Emission von Staatsanleihen ausgeben, allerdings kann die Zentralbank Geld schaffen, wenn sie direkt Staatsanleihen aufkauft, wobei allerdings weiterhin die Schuldenfähigkeit des Staates berücksichtigt werden muss.
Bezüglich der Frage der Inflation geht Shaikh zunächst davon aus, dass der Wettbewerb die relativen Preise durch die Ausgleichsbewegungen der Profitraten bestimmt. Das Wachstum der aggregierten Nachfrage kann durch neue Kaufkraft angeheizt werden, wobei das moderne Kreditsystem zumindest virtuell die Kaufkraft unbegrenzt anheizen kann, womit die Frage nach den Grenzen des Angebots auftaucht. Für Shaikh ergeben sich die Grenzen dadurch, dass keine Ökonomie eine höhere Akkumulationsrate als diejenige erzeugen kann, bei der der gesamte ökonomische Surplus reinvestiert wird (größer als die Profitrate): Shaikh setzt hier Ricardos Korn-Korn-Modell mit Marxens Schemata der erweiterten Reproduktion sowie mit von Neumanns und Kaldors Modellen gleich. Es geht darum, wie das maximale Wachstumspotenzial einer Ökonomie genutzt werden kann (Wachstums-Gebrauch-Index). Dabei ist der Fall einer gestiegenen Nachfrage qua neuer Kaufkraft bei begrenztem Angebot zu betrachten. Da die Profitrate die Rate von Profit zu Kapital, und die Akkumulationsrate die Rate des Investments zu Kapital ist, ist die Wachstum-Nutzen Index der Anteil des Investments am Profit.
Foto: Bernhard Weber
Die Wahrheit über den Kristallpalast, oder, im Resonanzraum von Einkaufszentrum und Discounter

Das Einkaufszentrum
Warum heute noch Baudrillard? Sicherlich sind heute viele der poststrukturalistischen Science-Fiction-Texte „dated“, und da machen manche von Baudrillard, abgesehen von der Zweifelhaftigkeit seiner Simulationstheorie, keine Ausnahme. Aber es ist gerade die Normalität der vielen von Baudrillard beschriebenen Phänomene, die einen unbekümmert und ignorant werden lässt, auch gegenüber Baudrillard selbst. Es scheint, dass hinsichtlich der drei von Deleuze beschriebenen Zeitsynthesen (Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft) beim heutigen Konsumenten ganz die Gewohnheit und Gegenwart regiert.
Für Baudrillard hatten wir es schon im Jahr 1970 mit einer Synthese von Fülle und Kalkulation zu tun, für die die Shoppingmall einen ausgezeichneten Ort darstellt. Viel später führt er aus, dass das postmoderne Subjekt das Leben einer Katze führe, die sich sich in einer indifferenten und hochdesignten Häuslichkeit wohlfühle. In diesem Kontext sollte man das Einkaufszentrum nicht nur als eine wie auch immer optimierte Anordnung von Warensorten verstehen, sondern als eine Verquickung von Zeichen, die geteilt sind, Teile einer Totalität von Wohlstands-Zeichen. Das Kulturzentrum, das die globale Mittelschicht heute mit ihren Leitwerten der Weltoffenheit, Toleranz und Cleverness ausschmückt, mutierte früh zum integralen Bestandteil des Einkaufszentrums, in dem die Ware kulturalisiert und in spielerische Eleganz und distinktive Substanz verwandelt wurde. Die Waren bieten sich in der Shoppingmall als Manna dar, wobei die Preise, in denen sich alles ausdrücken lässt, oft ein Geheimnis bleiben, weil man sie nicht als Resultate der Produktion versteht.
In einer Art Kamerafahrt fließen und zirkulieren die Konsumenten kollektiv und meistens doch ohne jeden aktuellen Kontakt im hermaphroditischen Milieu der Mode durch die klimatisierten Einkaufszentren, die sie am Ende verdaut und einer homogenen Fäkalmaterie anheimgibt. (Baudrillard 2015: 47) Man braucht zur Steigerung der Zirkulationsgeschwindigkeiten ununterbrochen eine Art unsichtbarer Gewalt, die in Raumtemperatur angeboten und konsumiert wird. Shoppingmalls sind Zonen des Durchquerens, die in ihrer nüchternen und ernüchternden affektlosen Fluidität die Durchquerenden und Durchquerten einer kinoesken Flüchtigkeit aussetzen und eine Kinetik der Transitlandschaften in Gang setzen. Mit beschleunigter Geschwindigkeit gleiten nicht nur die Körper der Shopping-Movers reibungslos durch Korridore und Boutiquen, auch die Blicke werden durch sämtliche Komfort-Installationen der Center geleitet. Permanent-Vacation bzw. Travelling-Panoramieren unter Kontrolle unsichtbarer Verbreitungsalgorithmen inkludieren die Formatierung der Verflüssigungsprozesse, welche die Shopping-Mall zur Datenstation machen, die den Spaß des Zuviel zwar anbietet, aber ihn im gleichen Moment negiert. Raum, der gleichzeitig fern und nah ist, obgleich permanent in Bewegung, kadriert in Boutiquen, Elektronikshops, Mulitmedia-Restaurants, Designerbars und in die weißen Elemente aus Licht. Wo der Wunsch mit sich selbst spazieren geht, als eine Tendenz oder ein Streben, sucht er im Einkaufszentrum für die Waren die passenden Konsumenten und für die Konsumenten die passenden Waren. Der Konsum ist ein Medium, in das verschiedene Formen der Selbstdarstellung und –vermarktung, der Images oder der Lifestyle-Konzepte eingestanzt sind, wobei die Verbreitung eines neuen Trends (Anrufung des Abweichens von der Norm) wie ein unbekannter Verbreitungsalgorithmus funktioniert, der für die Individuen das Einfädeln in Konsumschleifen ermöglicht (das wenig mit einer individuellen Kaufentscheidung zu tun hat), von den Werbe- und Designerindustrien eingespeist und den Hype auslösend, eine affektive Einstimmung der Körper forcierend; Shoppen hängt sich an die Waren und ist doch eigenartig gegenstandslos, nicht nur weil das Shoppen um des Shoppens willen in der Tautologie der Erlebniswelten und im Triumphalismus selbstreferenzieller Einkaufstempel funktioniert, die eben das Shopping umranden und inszenieren, indem sie die Kauf-Ströme kanalisieren, sondern weil das Shoppen zunehmend als Client-Server-Verhältnis stattfindet, welches Erlebniserweiterungsmittel, Erlebnissteigerungsmittel sowie Erlebnisersatzmittel per E-Empire in allen Zeitzonen in Echtzeit bereitstellt, sodass Shopping im Medium selbst stattfindet, in dem User, Interface und Screen neue Märkte generieren.
Baudrillard zufolge gibt es im Konsum nur scheinbar die Freiheit des Verbrauchers. Der Überfluss an Objekten und Konsummöglichkeiten sei eher einem magischen Denken verhaftet. Die Monströsität voller bunter Regale lebe nicht vom Versprechen auf Bedürfnisbefriedigung, sondern vom "Überfluss" der Zeichen und der "Akkumulation der Zeichen des Glücks" (ebd: 48). "Es geht um das konsumierte Bild des Konsums. Das ist die neue Stammesmythologie, die Moral der Moderne." (Ebd.: 284/5) Und weiter: "Es ist also nicht richtig, dass die Bedürfnisse Ergebnis der Produktion sind, vielmehr ist das System der Bedürfnisse das Produkt des Produktionssystems." (Ebd.: 109) Damit verweist Baudrillard nicht nur auf die Ubiquität einer Wunschmaschinerie, sondern akzentuiert im System des Überflusses und des Wohlstandes auch die Knappheit, da gegenüber den gesteigerten Bedürfnissen und Wünschen die finanziellen Mittel zur Bedürfnisbefriedigung immer wieder zurückfallen und zugleich ein Kreislauf des Begehrens entsteht, der nicht enden will.
Günther Anders hatte dies wiederum schon einige Jahre früher vermerkt: „Nein, trotz der ungeheuren Vermehrung und Ausbreitung technischer Kenntnisse und trotz des natürlich allgemeinen Wissens, daß die Produkte nicht an Bäumen wachsen, sind diese doch für die Mehrzahl der Zeitgenossen primär nicht als Produkte da, und gewiß nicht als Zeugnisse der eigenen prometheischen Selbstherrlichkeit; sondern einfach „da"; und zwar primär als Waren, als nötige, wünschenswerte, überflüssige, erschwingliche oder unerschwingliche, die „meine" erst dann werden, wenn ich sie gekauft habe. Sie sind sogar eher Beweisstücke eigener Insuffizienz als eigener Kraft: allein schon deshalb, weil der Überfluß der ausgestellten unanschaffbaren Produkte in einem hochindustrialisierten Landeeinfach überwältigend ist: die Ladenstraße ist ja die permanente Ausstellung dessen, was man nicht hat.“ (Anders 1961: 28)
In den 1990er Jahren konstatiert Arthur Kroker in der "Panik-Enzyklopädie" das Ende Faszination an der Shoppingmall, die nun zu einem liquiden TV-Bildschirm geworden sei, allerdings gegenüber dem Fernsehen den Vorteil besitze, dass sie alle Sinne anspreche und die Körper in eine Multiplizität von Organen verwandele, aber ihre Versprechen gegenüber dem durch und durch possessiven Individuum jedoch nur virtuell erfülle.
Der Discounter
Wer im Jahr 2000 glaubte, in der sog. Posthistoire würde Sloterdijks Wiederauferstehung des Kristallpalasts dem postmodernen Einkaufszentrum den Garaus machen, der sieht sich heute gründlich getäuscht. 2000ff., das ist (in den westlichen Metropolen) vor allem der Siegeszug der Discounter (und der Alditude), die nicht nur von den Unterschichten und dem Prekariat, sondern auch von einem Teil der Mittelschichten regelmäßig besucht werden. Dabei stehen Discounter und Reallohnsenkung in einer innigen Beziehung, sie verstärken einander in ihrer Existenz. Natürlich versorgen die Discounter insbesondere die Unterschichten nachhaltig und billig mit krankmachenden Substanzen - Fett, Zucker, Alkohol, Nikotin und Salz -, um unter anderem ein statistisch berechenbares Krankheitsbild zu erzeugen. Die Discounter, die anstatt der fluiden TV Bildschirms der Einkaufszentren den indiskreten Charme der Anstalt re-etabliert haben, in der auf den Genuss gründlich geschissen wird, sind zudem Anbieter von billigen Gadgets, Games und Zeichenwaren, sie sind das Kulturzentrum und die Wahrnehmungsmaschine der Unterschicht. Meterlange Verpackungsreihen, serielle Anordnungen und effizientes Design haben in diesen zivilisierten Elendsräumen das Ende des Ornaments, der Inszenierung und der Ausstellung bzw. des Fetischismus (Kristallpalast und Passagen) besiegelt. Die Differenzproduktion der Waren wird hier durch Ähnlichkeit (dividuiert, mitförmig) ersetzt und zum homogenen Konsumformat geglättet. Und der Sicherheitsdienst weist leise darauf hin, dass man im Discounter nicht nur als kaufkräftiger Kunde, sondern auch als Ladendieb in Empfang genommen wird. Die gewaltige Positivität der Discounter manifestiert sich als Homogenität und zugleich als kaufbare Simulation des Exzesses, als reguliertes Zuviel, dem jede Negativität abhanden gekommen ist. Kein Wunder, dass die Menge Warenmüll mit dem Wortmüll korreliert, den die Konsumenten auf Straßen, Plätzen, in Bus und Bahn verstreuen. Die als Weltoffenheit und Toleranz ausgegebene Pornographie der Hyper-Kommunikativen mästet sich am Exzess des Gleichen, schließlich sei ja schon alles gesagt. Oder, um es anders zu sagen, man sagt, was alle sagen, man hat, was alle haben, und man grillt, wenn alle grillen. (Metz/Seeßlen 2011)
Der Staat berechnet heute die Höhe seiner Sozialleistungen nach den Preisen der Discounter. Die Zwangsernährungskonzerne (ebd.) werden durch die wachsende Armut stetig reicher (Zwangsernährer und Beschleuniger der Armut), während sie die Armut der Konsumenten erträglich machen und durch ihre aggressive Politik gegenüber Angestellten, Konkurrenten und Zulieferern auch neue Armut schaffen.
Somit gilt es Sloterdijks Aussagen zum Mehrkonsum unbedingt zu relativieren. Er schreibt: “Die kollektive Bereitschaft zum Mehrkonsum konnte innerhalb weniger Generationen in den Rang einer Systemprämisse aufsteigen: Massenfrivolität ist das psychosemantische Agens des Konsumismus.“ (Sloterdijk 2016: 123) Mehrkonsum ergibt sich für Sloterdijk weniger aus der Kapitaldynamik, sondern als Resultat des unverdienten Zuflusses von Energie in die Ökonomie (Fossilenergetik, aber auch Maschinisierung. Dampfmaschinen, Verbrennungsmotoren und Elektromotoren). Sloterdijk zitiert weiterführend Rolf Peter Sieferle: „Letztlich ernähren wir uns von Kohle und Erdöl - nachdem diese in der industriellen Landwirtschaft zu eßbaren Produkten verwandelt worden sind.“ (Ebd.: 127)
Aus den Oxfam Studien weiß man, dass die reichsten 1% mehr an Reichtum besitzen als der Rest der Welt. Geht man jedoch davon aus, dass Teile der Vermögen unregistriert in Offshorezentren liegen, dann ist das eine eher konservative Schätzung. Gegenwärtige Schätzungen gehen davon aus, dass die Superreichen $32 Billionen in Offshorezentren lagern, ein 1/6 der weltweiten privaten Vermögen. Aber es geht nicht nur um Ungleichheit der Vermögensverteilung, sondern auch um die der Einkommen. Letztere wird mit dem Gini-Index gemessen. Die Zahl Null steht hier für totale Gleichheit und die Zahl Eins für totale Ungleichheit. Nach den Zahlen de Ökonomen Branko Milanovic ist der Index von 1988 von 0.72 im Jahr 2008 auf 0.71 gefallen. Aber der Gini-Index misst nur relative Veränderungen. Wenn die Einkommen der Reichen und der Armen mit derselben Rate wachsen, dann bleibt der Gini-Index identisch, selbst wenn die absolute Ungleichheit ansteigt. Wenn die Person A 1000 Euro und die Person B 100 Euro besitzen, und beide nun ihr Einkommen verdoppeln, dann bleibt der Gini-Index identisch, selbst wenn die Differenz der Einkommen sich von 900 Euro auf 1800 verdoppelt hat. Wenn man den absoluten Gini-Index ansetzt, dann ist er als Folge der neoliberalistischen Politiken von 0.57 im Jahr 1988 auf 0.72 im Jahr 2005 gestiegen. Allerdings muss man davon ausgehen, dass die durchschnittlichen Einkommen heute höher als in den frühen 1960er Jahren sind, sodass man bspw. den Versuch, die Unterkonsumtionstheorie zur Erklärung der gegenwärtigen Rezession heranzuziehen, von vornherein zurückweisen darf.
Der Konsum
Doch ist die Shoppingmall nicht verschwunden. Und natürlich auch das von Baudrillard beschrieben Konsumsystem nicht, obgleich sich doch einige Modifikationen nachweisen lassen. Für Baudrillard sind nicht die Objekte das primäre Ziel der Bedürfnisbefriedigung, sondern das mit ihrem Kauf erworbene Prestige. Konsum ist ein Prozess der sozialen Differenzierung und Klassifizierung. Die Zeichen und Produkte zeigen nicht nur signifikante Differenzen im Code an, sondern sie manifestieren eben auch Statuswerte einer sozialen Hierarchie der Klassen. Dabei wird das Distinktionsverhalten von den Konsumenten als Freiheit erlebt und nicht als Zwang sich differenzieren zu müssen und einem Code zu gehorchen. Der Konsum erzwingt laut Baudrillard die emotionale Pflicht zum Genuss. Es handelt sich um einen systematisch und systemisch organisierten Konsum. (Das ist etwas ganz anderes als die in der Bataille`schen Ökonomie angesprochene Verausgabung und Vergeudung, deren hervorragendster Akteur die Sonne ist, die sich mit reiner Grundlosigkeit verschwendet.) Sein Vergnügen erlebt der Konsument als absolut, ohne den strukturalen Zwang überhaupt noch zu registrieren, wobei dieser zudem für den permanenten Wechsel sorgt, aber die Ordnung der Differenzen erhalten bleibt. Baudrillard konstatiert einen Zwang zur Relativität, der den Rahmen für eine nie endende Differenzierung liefert. Und exakt dies erweist sich als Grenzenlosigkeit des Konsums. Während das Prestige an der positiven Differenz klebt, kennen die distinktiven Zeichen zudem noch die negative Differenz: Man konsumiert nicht das Objekt, man folgt lediglich der Manipulation der Objekte als Zeichen.
So mutiert das Produkt zu einem austauschbaren Zeichen des Begehrens, mehr noch, die Produkte und Wünsche tendieren zu einer „generalisierten Hysterie". Der Konsum fördert eine Art objektloses Verlangen, ein Verlangen, das auch ohne die Objektwahl und schließlich die Konsumtion des Objekts insistiert. Deshalb kann die ultrapopuläre Kochshow in den heutigen Dimensionen überhaupt erst funktionieren, denn der Prolet, der vom realen Distinktionsgenuss weiterhin ausgeschlossen bleibt, findet anscheinend nichts dabei, wenn bei seiner Konsumtion nur die Augen mit-essen, geht es in gewisser Weise hier doch um den Genuss Kochkünste der Köche und von Höchstleistungen, die an den Profisport erinnern. Somit orientiert sich der Konsum nicht am Gebrauchswert, sondern an der Produktion und Manipulation sozialer Semiotypen und Signifikanten, oder, um es anders zu sagen, der Konsum ist ein Prozess der Signifikation und der Kommunikation, basierend auf einem (klassenspezifischen) Code, der sich beständig und zugleich unsichtbar in die Konsumpraktiken einschreibt. Konsum ist ein System des Tauschs und ein Äquivalent der Sprache. Allerdings vollzieht sich das Tauschsystem des Kapitals und eben auch die Konsumtion in einer Art Spiralbewegung, in der insbesondere für die gehobenen Mittelschichten die Bedürfnisse derart differenziert werden, dass ihre vollkommene Deckung nicht mehr möglich ist und die Befriedigung des banalen Bedürfnisses ein reflexives Bedürfnis weckt. Schließlich mutiert für den Kaufsüchtigen das Konsumobjekt bzw. die Ware zum Müll. Dann werden die erworbenen Produkte im Keller gestapelt oder in Vitrinen abgelegt, weil allein der Genuss des Kaufakts zählt, der wiederum durch die Information angekurbelt wird. Baudrillard fügt richtigerweise hinzu, dass die Wünsche und die Produkte keineswegs nach derselben Logik und Rhythmik produziert werden. Während die Warenproduktion von der Produktivität des Kapitals abhängig bleibt, basiert die Wunschproduktion auf kultureller Differenzierung. Die Differenzierung der Produkte ist also in Relation zur Differenzierung der Wünsche zu setzen (die of course in letzter Insatnz durch die Einkommen definiert werden). Dabei wachsen die Wünsche schneller als die verfügbaren Güter. Kurzfristige Abhilfe verschafft der Konsumentenkredit, wobei der Konsument sein zukünftiges Einkommen für gegenwärtigen Konsum verwendet bzw. eine Ego-Bank mit einem feinen, kleinen Kreditgeschäft betreibt, bei dem sich die auf Kredit gekauften Waren als Sicherheiten für neue Kredite erweisen - je mehr Kredite man aufnimmt, desto mehr Kredit erhält man.
Konsum ist weder die Kenntnis der Welt noch ihre Ignoranz, sondern ihre Verkennung, die durch ein permanent gereizte Neugier vorangetrieben wird. André Gorz hatte schon vor 30 Jahren angemerkt, dass die in den Marketing-Abteilungen beschäftigten Spezialisten genau wüssten, dass den produzierten überflüssigen Müll von sich aus niemand kaufen würde. Der Konsum fördert zum einen das aktive Moment (alles muss ausprobiert werden), eine generalisierte, in diffuse Umtriebigkeit verwandelte Neugier, zum anderen verspricht er Beruhigung und entspricht der Einnahme von Tranquilizern. Das entspricht ungefähr dem von Žižek konstatierten Siegeszug von Produkten, welche die Paradessenz des Produkts (Entspannung und Erregung zugleich, bspw. beim Kaffeekonsum) entschärfen (alkoholfreies Bier, entkoffeinierter Kaffee, fettarmer Joghurt etc); der Konsum implementiert eine adversative Struktur des ubiquitären Genießens: Verfolge durch Mehr-Essen konsequent den Weg zur Bulimie, um das Ziel, das Anorexie verspricht, zu erreichen bzw. iss mehr, um schneller abnehmen zu können, womit einerseits die Teilnahme am Genuss qua Imperativ zugesichert, andererseits das exzessive oder sogar suchtbringende Moment, das dem Konsum mancher Produkte anhängt, zugleich entschärft wird. So dass man sich schuldig fühlt, wenn man sich nicht mit dem Surrogat begnügt, sondern den süchtig machenden Alkohol, Nikotin, Zucker konsumiert. Ähnliche Tendenzen finden wir beim Konsum der Diszipliniken (Potenzsysteme, inklusive Ästhetik, Akrobatik und Therapeutik, klinische Kriterien und Selbsttechnologien, Gastronomik und (digitalisierte) Spaßtechnologien, plus deviante Sexualprozeduren und Ritualistiken des Doping und des Medikamentenkonsums, diverse Trainingstechniken).
Die von Baudrillard als Standardpaket titulierte Konsumnorm bezeichnet weniger die Materialität der Produkte als ein bestimmtes Konformitätsideal. Die Funktionen des Marktes und ihrer Motivationsforschung bestehen darin, eine konstante Nachfrage für die Märkte zu erzeugen. Das System der Wünsche regrediert zu einer Manövriermasse innerhalb des Produktionssystems, die Baudrillard als Konsumtivkraft bzw. als die Form der rationalen Systematisierung der Produktivkräfte auf individueller Ebene bezeichnet. Im System der Zeichen sind die Produkte nicht mehr an ein Bedürfnis oder eine Funktion gebunden, sondern enthalten ein bewegliches und unbewusstes Signifikationsfeld. Es gibt im System allgemeiner Austauschbarkeit andauernd Verschiebungen zu vermelden, womit auch der Wunsch nach Unterscheidung beim Konsumenten nie zu einem Ende kommt.
An dieser Stelle kann man Baudrillard zusammenfassen: 1) Der Konsum ist keine Funktion des Genusses, sondern eine Funktion der Kapital-Produktion, womit er eine kollektive Funktion besitzt. Bei Produktion und Konsumtion handelt es sich um ein und denselben logischen Prozess der Reproduktion des Kapitals. Konsumenten werden einem kollektiven Code zugeordnet, ohne dass Solidarität entsteht, ganz im Gegenteil. 2) Der Konsum stellt die Anordnung der Zeichen und die Integration der Klassen sicher. 3) Konsum beruht auf einem Code der Zeichen und ihren Differenzen. Dabei definiert die industrielle Produktion von Differenzen das Konsumsystem. Die Differenzen dienen der Gefügigkeit gegenüber dem Code, der Integration in eine mobile Werteskala. 4) Der Konsum impliziert weniger den funktionalen Umgang mit Produkten, sondern basiert auf einem ausgeklügelten Kommunikations- und Tauschsystem.
Norbert Bolz, der das "Konsumistische Manifest" verfasst hat, singt hingegen das neoliberale Loblied auf den Konsum. Bolz bezeichnet den Konsumismus als das Immunsystem der Weltgesellschaft. Wenn alle Menschen auf höchster reflexiver Stufe konsumieren, werde es keinen Fundamentalismus und auch keinen Terrorismus mehr geben. Was aber Bolz als reflexiven Konsum abfeiert, das sind die von David Foster Wallace verhandelten Konsumpraktiken des grün-urbanen Konsumenten, der - Medien und Marketing erprobt - glaubt, er sei mit dem entsprechenden Durchblick ausgestattet, um gegenüber den Marketingkampagnen der Industrie immun zu sein und damit umso reflexiv erfrischender jene Markenkultur genießen zu können, gegen die er sich ja immun wähnt, und er kann das, weil für ihn der Markt nicht einfach nur als Vermittler von Waren erscheint, sondern ganz neoliberal als effektiver Informationsprozessor. Man befürwortet die eigene Selbstverwandlung durch Konsum, weil man angeblich gerade dadurch das System unterläuft, das einem nur von außen eine Identität aufzwingt. Die umworbenen Zielgruppen sollen glauben, dass sie gegenüber dem Marketing, der Propaganda und der Verführung immun seien, während sie sich doch gerade im Zuge des Immunisierungshypes in das Konsumsystem einfügen. Philip Mirowski schreibt: „Gelebte Erfahrung wird durch Lifestyles ersetzt, wobei es den Widerspruch zwischen Zugehörigkeitsgefühl und Individualität auszuhalten gilt.“ (Mirowski 2015: 2714; Kindle-Edition) In diesem Kontext gewinnen FairTrade und andere ethisch orientierte Konsumweisen eine behagliche Note, schließlich feiert man im ethischen Konsum eher den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, als dass man etwas an den Produktions- und Distributionsweisen solcher Produkte wie Kaffee ändert. Ethischer Konsum dient dazu, die staatlich regulierten Arbeitsbedingungen, produktions- und Produktstandards auszubremsen und alles dem Informationsprozessor Markt zu überlassen. Rebellion ist mutiert zum Freizeitvergnügen. Simulierte Rebellion im Konsum und Guerilla-Marketing laufen ineins. Und es gibt ein Marketing, das sich zum Teil aus freiwilliger unbezahlter Arbeit speist, wobei man den freiwillig Arbeitenden das Gefühls des Gebens vermittelt, während der Empfänger ihrer Gabe ein Unternehmen ist.
Die Freiheit des Konsums ist für Baudrillard eine reine Mystifizierung, vielmehr wird die Wahlfreiheit im Konsum aufgenötigt; das System des Konsums vervollständigt das ebenfalls aufgezwungene Wahlsystem - Shoppingmall und Wahlkabine sind systemisch produzierte Orte der individuellen Freiheit, die beide nur noch konsumiert werden. Ähnlich hatten das schon Adorno/Horkheimer formuliert: „Aber Reklame wird Information, wenn es eigentlich nichts mehr zu wählen gibt, wenn das Wiedererkennen der Marke den Wahlvorgang substituiert und wenn zugleich die Totalität des Systems jeden, der sein Leben erhalten will, dazu zwingt, solche Leistungen aus Berechnung zu vollbringen. Das geschieht unter der monopolistischen Massenkultur. Drei Stufen in der Entfaltung der Herrschaft übers Bedürfnis lassen sich unterscheiden: Reklame, Information, Befehl. Als allgegenwärtige Bekanntmachung führt die Massenkultur diese Stufen ineinander über.“ (Adorno/Horkheimer 1969: 133)
Aufgenötigt wird auch der Konsum zweiter oder dritter Ordnung, der die ständige Selbstverwandlung der Konsumenten integrieren soll. Dabei wird ihm sogar suggeriert, dass er im und mit dem Konsum Projekte organisiert, mit denen er jeden Versuch des Marketings, ihm eine von außen aufgezwungene Identität aufzustülpen, unterläuft. Mehr noch, Konsumenten kaufen Produkte ohne sie zu gebrauchen, sondern sie setzen sie für Werbung ein, die wiederum neuen Konsum generiert. So wird ein Teil der Werbung von Konsumenten generiert, die dafür unbezahlte Arbeit leisten.
Beim Verhältnis von Konsum und Zeit geht man laut Baudrillard von drei Voraussetzungen aus: Die Freizeit ist das Reich der Freiheit. Jeder Mensch ist von Natur aus frei und gleich. Die Zeit ist die Dimension apriori. Sie ist da und wartet auf uns. Der Anspruch der Freizeit besteht darin, der Zeit wieder ihren Gebrauchswert zurückzugeben, jedoch kann sie im Kontext der Freizeitindustrie nur als chronometrisches Kapital von Jahren, Stunden und Minuten befreit werden, in das man investiert. Zeit bleibt deshalb knapp und den Gesetzen des Tauschwerts unterworfen. Nicht nur die Arbeitszeit, sondern auch die Konsumzeit - die gewonnene freie Zeit durch ein Produkt beispielsweise, das flüssig konsumiert und nicht erst tiefgefroren aufgetaut werden muss – mutiert zum verzinslichen Kapital, zur virtuellen Produktivkraft, die man kaufen muss.
Im Kontext der therapeutischen Fürsorge, einen weitere Nebenwirkung des Konsums, regredieren die Konsumenten schließlich zu Pflegefällen: »In diesem Sinne noch einmal die TWA, die »Fluggesellschaft, die Sie versteht«. Und sehen Sie, wie gut sie Sie versteht: »Für uns ist der Gedanke kaum erträglich, Sie ganz allein in ihrem Hotelzimmer zu wissen, wie Sie wild durch die Fernsehprogramme zappen. Wir wollen alles tun, damit Sie auf Ihrer nächsten Geschäftsreise Ihre bessere Hälfte mitnehmen können ... mit dem speziellen Familientarif usw. Mit ihrer besseren Hälfte an Ihrer Seite haben Sie zumindest jemanden, mit dem Sie den Fernseher umschalten können ... das ist es, was wir Liebe nennen ...« Die Frage ist nicht, ob Sie allein sind - Sie haben nicht das recht dazu, denn »für uns ist das unerträglich«. Wenn Sie nicht wissen, was Glücklichsein bedeutet, werden wir es Sie lehren, wir wissen das nämlich besser als sie und wissen auch, wie Sie mit ihrer »Hälfte« vögeln sollten,wo sie doch Ihr »Zweites Programm, Ihr erotischer Sender ist. Das wussten Sie nicht? Dann werden Sie auch das bei uns lernen. Denn dazu sind wir da. Sie zu verstehen - diese Aufgabe ist die unsrige … (Baudrillard 2015: 249)
Die im Hintergrund des Konsums wabernde Philosophie
Nietzsche schafft eine Typologie der Langeweile, in der die Langeweile zunächst ein positives Zeichen für das Leben eines Gelehrten ist, während der gewöhnliche Denker vor der Langeweile flieht und mit seiner Teilhabe in den Unterhaltungsmaschinerien Zerstreuung sucht, Mode, Musik und Kunst, im Reisen oder im Sportbetrieb, all den Codierungen bzw. symbolisch-kommunikativen Sinnstiftungen, die der Integration der Masse dienen. Die „gute“ Langeweile gleicht dagegen einem Schwebezustand, der zwischen formloser Wahrnehmung und dem Bedürfnis nach Gestaltung pendelt. Heidegger ahnte wohl, dass die ontologisch-existentiale Stimmung des Man als ein Ängstlich-Sein-zum-Tode in den modernen Differenzkulturen in das umkippt, was er ein Gelangtweilt-Sein-zum-Tode nannte. Die begünstigten Konsumenten unserer Metropolen erscheinen keinesfalls von Angst zerfressen, sondern trotz des 24-Stunden-Entertainments oder womöglich des Konsums von Extremsportarten eher gelangweilt oder abgebrüht zu sein, ausgelaugt durch die versicherten Wiederholungsstrukturen der täglichen Routine, aber phasenweise auch wieder köstlich amüsiert, beim internetgestützten Ballermann-Sex bis hin zum Boxenstopp-Sex an der Reichtumsspitze der Gesellschaft, etwa in der Flavio-Briatore-Klasse; alles in allem leiden die Konsumenten unter dem Vergnügen und den viel zu vielen Möglichkeiten - die Möglichkeit als die härteste Droge? Die Todesdroge? -; simultan gehen die Konsumenten zu abgrundtief schlechter Langeweile durch Shoppingmalls spazieren und oft genug gerinnt die »gute« Langeweile zur trivialen Frustration und taut hier und da in Gewaltexzessen wieder auf, oder man lässt Cloning, plastische Chirurgie und Doping zu attraktiven Spitzentechnologien avancieren, nicht zuletzt Telematik, Informatik und Netzwerkindustrie, die nebst globalisierter Partnersuche, Avatarkram sowie Dirty-Chatting die Eigenkonstruktion eines Second Life ermöglicht, etwa die Einrichtung imaginärer Bordelle, wo die Sexuser, ganz »Man« geworden, beliebig modellierte Partnerinnen oder Partner zu Sexparties einladen, um in komplexen Stimmungen eines implizit Unbewussten zu baden, den Stimmungslagen des Gelangweilt-Werdens von etwas und des Sich-Langweilens bei etwas. Fraglich bleibt, ob die gelangweilten und zugleich stark amüsierten Subjekte in der Lage sind, jene dritte, tiefe und fundamentale Schicht, die Heidegger zumindest angenommen hat, zu registrieren, die Leere einer neoliberalen Risikoindustrie, die permanent versucht sich abzusichern oder die anderen zu versichern. Und wird die Langeweile von einer Person nicht mehr ausgehalten, so wendet sie sich gegen sich selbst oder schlägt in den Aktionismus von hyperaktiven, sich selbst disziplierenden, lehrenden und lernenden, also übenden Subjekten um. Man denke an das Paradox eines weinenden oder lachenden Roboters. Die übermäßige Erregbarkeit ist der Gegenpol zur Langeweile, wobei die Pendelbewegungen das einigende Band sind, eine ubiquitäre Form des Bemühens, mit der Leere der Risikoindustrie, die zugleich zur Aktivierung aufruft, auszukommen. Die Erregbarkeit manifestiert sich in allen möglichen Spielarten von Süchten oder mündet in Netzwerk-Abhängigkeiten, in der Klammer, der Relation von Wiederholungsmustern des Verhaltens und der Kontrolle. Aber leben wir damit schon in einer Welt jenseits des Sinns? Nein, agt der Philooph, eher in der Überfülle von Sinn. Die Zukunft unserer technologischen Selbstmanipulation qua Digitalisierung, Biogenetik und Prothesenherstellung erscheint uns nur sinnlos, wenn wir sie innerhalb des Horizonts unserer Vorstellungen dessen, was ein sinnvolles Universum ist, messen. Zugleich hat das Kapital als erstes sozioökonomisches System die Bedeutung enttotalisiert; Kapital kann sich im Zuge des Nihilismus jeder Kultur anpassen, jeder Religion, denn allein die Realität der profitorientierten Märkte & Netzwerke im Sinne von bedeutungsloser Sinnproduktion zählt. In Zeiten von Junk News, Junk Food, Junk Money und Junk Selfishness schauen nicht Mdien, wir leben Medien. Machtimplosionen lassen angesichts des geistig-affektiven Zustands seiner Bewohner gar nichts Gutes erwarten.
Literatur
Adorno, Theoder W./Horkheimer Max (1969) : Dialektik der Aufklärung. Frankfurt/M.
Anders, Günther (1961): Die Antiquiertheit des Menschen 1. Über die Zerstörung des Lebens im Zeitalter der dritten industriellen Revolution. München.
Baudrillard, Jean (1982): Der symbolische Tausch und der Tod. München.
- (2015): Die Konsumgesellschaft. Ihre Mythen, ihre Strukturen. Berlin.
Metz, Markus/ Seeßlen, Georg (2011): Blödmaschinen. Die Fabrikation der Stupidität. Frankfurt/M.
– (2012): Kapitalismus als Spektakel. Oder Blödmaschinen und Econotainment. Frankfurt/M.
Mirowski, Philip (1986): The Reconstruction of Economic Theory. Berlin.
- (2015): Untote leben länger. Warum der Neoliberalismus nach der Krise noch stärker ist. Berlin.
Sloterdijk, Peter (2016): Was geschah im 20.Jahrhundert? Frankfurt/M.
Foto: Bernhard Weber
Capitalizing Obesity

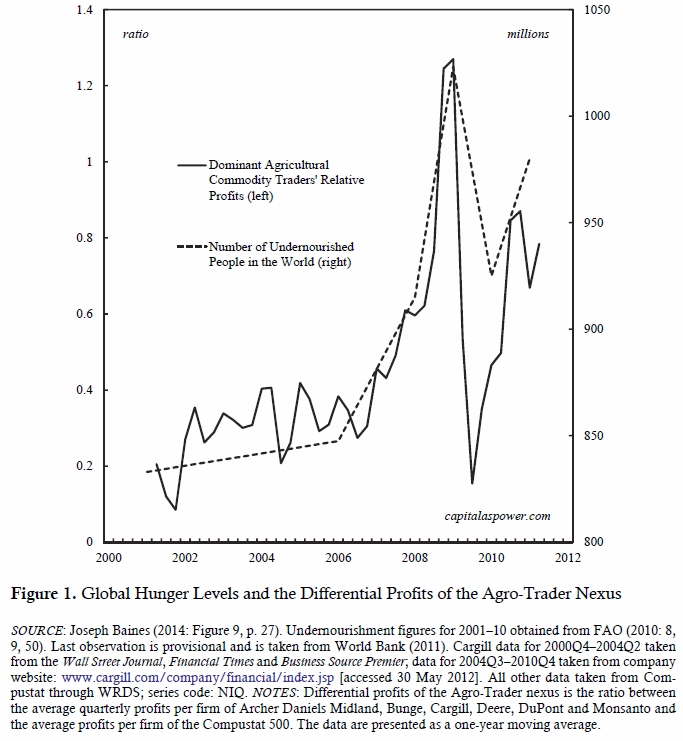 The Other Side of Hunger
But the capitalization of food is a dialectical process. As Michael Harrington noted more than half a century ago in his seminal book The Other America (1962), the other side of affluence is poverty; and among the American poor, the other side of hunger is overweight and obesity.
Fifty years later, Harrington’s insight has grown into a global menace (for a detailed overview, see Albritton 2009). Figure 2 shows data from a long-term study published in The Lancet (Essati 2016). The data demonstrate that, for the first time in history, there are now more obese than undernourished people in the world (roughly 13% compared to 9% as of 2014), and it suggests that, looking forward, obesity is likely to pose a far greater health hazard than undernourishment. (Note the gender dimension: women tend to suffer more than men from both undernourishment and obesity, but the female-male disparity in the latter predicament is much greater than in the former.)
The Other Side of Hunger
But the capitalization of food is a dialectical process. As Michael Harrington noted more than half a century ago in his seminal book The Other America (1962), the other side of affluence is poverty; and among the American poor, the other side of hunger is overweight and obesity.
Fifty years later, Harrington’s insight has grown into a global menace (for a detailed overview, see Albritton 2009). Figure 2 shows data from a long-term study published in The Lancet (Essati 2016). The data demonstrate that, for the first time in history, there are now more obese than undernourished people in the world (roughly 13% compared to 9% as of 2014), and it suggests that, looking forward, obesity is likely to pose a far greater health hazard than undernourishment. (Note the gender dimension: women tend to suffer more than men from both undernourishment and obesity, but the female-male disparity in the latter predicament is much greater than in the former.)
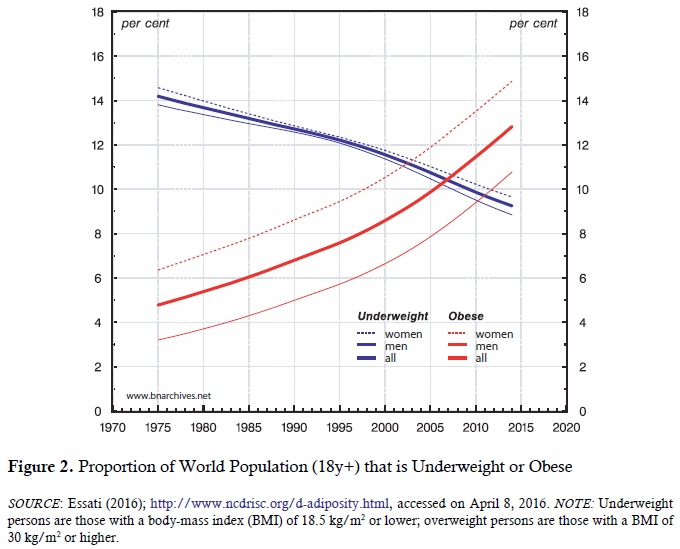 There is a fundamental biological difference between undernourishment and obesity: while hunger drives the undernourished to eat more if they can, there is no parallel instinct propelling the obese to eat less. On the contrary. The human body, having evolved during the long Palaeolithic epoch of hunting and gathering, craves salt, sugar and fat. But this very craving – which was necessary for survival in Palaeolithic times – became destructive once salt, sugar and saturated fat grew abundant (Harris 1989; Diamond 2012: Ch. 11). And because humans have limited natural defences against their own cravings, obesity is now an easier to inflict – and potentially more profitable – form of capitalized sabotage than undernourishment ever was. So, in the end, although undernourishment and obesity are biological opposites, they share a basic social similarity: they are both instruments of power.
Power in Hunger
Hunger has been a central lever of power throughout history. The earliest state civilizations of ancient Mesopotamia and Egypt were made possible, first and foremost, by the domestication of grains, particularly barley. The abundance of grains produced by the workers and slaves of these societies helped sustain a triangular complex of palace-temple-army, which in turn fed and provided for – as well as threatened, organized and ruled – their underlying propertyless populations. The central role of food in this process is imprinted all over the artistic carvings and drawings of these early societies: they portray their rulers as large, weighty and often overwhelming, while the ruled are shown as small, skinny and hunched over.
The Middle Ages too were organized around food. In the feudal regimes of Europe and Japan – as well in the empires of China, the princely states of India and the caliphates of the Middle East – the rulers controlled the land or its produce, and, by extension, the peasants who cultivated it. Their main threat was expulsion or extraction: for the tillers, being kicked off the land or deprived of its crops often meant hunger, privation and early death.
The transition to capitalism didn’t change the basic equation, at least not initially. The new liberal individual was obsessed with income and wealth; but the reason for this obsession was still the looming threat of poverty and hunger – the ultimate ‘scarcity’ of the capitalist universe. According to many, it was the permanent threat of hunger, amplified by a growing enclosure movement, that propelled the feudal population into the burgeoning cities, thus kick-starting urbanization and helping usher the Industrial Revolution. Hunger also anchored the classical political economy of Ricardo, Malthus and Marx, where the value of commodities was said to hinge on subsistence wages. And if we are to judge by the era’s novelists – from Balzac and Dickens to Hugo, Zola and Maupassant – the menace of hunger remained front and centre throughout the Victorian era. In the visual arts, the rulers, just like in antiquity, were portrayed as fat, healthy and long-living, while the ruled appeared underweight, sickly and ready to die.
Communism too was ruled by hunger. The Russian and Chinese revolutions were supposedly fought for human liberty and dignity. But as the communist masses were soon to learn, their new historically materialistic rulers – much like their divine predecessors – were particularly keen on leveraging the caloric intake of their subjects, usually to the latter’s detriment. Those who didn’t comply ended up in labour camps and other correctional facilities, where meagre portions of wheat and rice spelt want, sickness and doom – and all that while their rulers, generals and bureaucrats, like oriental despots, displayed their opulent bodies and multiple chins in official speeches and victory parades.
Twentieth-century capitalism promised an end to this spectre of hunger. The classical subsistence-wage labourer was replaced by a rational neoclassical ‘agent’. Having climbed out of poverty, the new ‘representative’ agent was no longer content with little food and shabby shelter; he or she became a ‘sovereign consumer’ determined to maximize his or her individual ‘utility’. Later on, with the spreading ritual of capitalization, the neoclassical agents were again remodelled – this time as walking ‘human capitals’ set on augmenting their ‘net worth’. The lives of these agents are still driven by ‘scarcity’, or so they are being told. They remain haunted by unlimited wants far exceeding their limited resources, and they still fight for ‘survival’. But unlike before, their fight now is said to be fuelled by the fervour of greed and the fear of being left behind, not by the threat of hunger and the prospect of extinction.
Power in Obesity
But this sea-change hasn’t eliminated food as a key lever of power. Far from it. Food is still a crucial form of social control – only that now it comes in a very different guise. Whereas until recently – and even today in parts of China, South Asia and Africa – the main threat for the underlying population was having too little to eat, nowadays it is having too much. The poor, traditionally punished by hunger, are now much more likely to be penalized by obesity.
This massive, ongoing transformation is reshaping the heart, mind and body of the capitalist subject. The undernourished, underweight, work-till-you-drop poor are gradually being replaced by their overfed, overweight, shop-till-you-drop descendants. And this inversion is hardly for the better. Although the adipose poor live longer than their scrawny predecessors, they are not necessarily healthier. They tend to suffer from non-communicable diseases – primarily diabetes, hypertension, strokes, cancer, heart attacks, atherosclerosis and other cardiovascular ailments (Diamond 2012: Ch. 11). And having been born into a hyper-capitalized complex of cheap industrial food, accessible pharmaceutical drugs and a highly intoxicating mass media, many of them are gradually losing their ability to control their inflating bodies and liberate their captured souls.
Ironically, this obesity revolution has been driven by wheat, rice, corn and potatoes – the very same crops that leveraged food power in the earlier hunger era. The plants that forced and lured hunters and gatherers into centralized state structures are now used – together with numerous supplements, both chemical and mental – to enslave capitalist subjects to their own irresistible cravings. And as the sedated, junk-food eating subjects become bigger and heavier, their previously ‘fat cat’ capitalist rulers eat organic, go to the gym and grow leaner and meaner. . . .
The Questions
There is nothing automatic, let alone natural, about this dialectic of food, poverty and power. The intertwined evolution of hunger and obesity is intimately connected to differential profit and accumulation. Both hunger and obesity represent complex levers of strategic sabotage, both get capitalized, and therefore both can be examined qualitatively and quantitatively. The capitalized dollar magnitude of this process – involving food, energy, pharmaceuticals, advertising and the mass media to the tune of trillions – makes it one of the key processes of modern capitalism, and therefore crucial to understand.
How has this remarkable hunger-to-obesity transformation evolved? What forms of capital drive the obesity epidemic, including its counter-movements of anti-obesity drugs, non-communicable disease treatments, diets, surgical fixes and psychological interventions? What are the material/ideal technologies that shift the world toward ever more destructive yet profitable forms of mass overfeeding? What policies and legislation have supported this shift, and how have they been imposed on the world’s population? And most importantly, what are the qualitative and quantitative links, if any, between these various strategies of sabotage on the one hand and differential profit and capitalization on the other?
Endnotes
[1] Shimshon Bichler teaches political economy at colleges and universities in Israel. Jonathan Nitzan teaches political economy at York University in Canada. All of their publications are available for free on The Bichler & Nitzan Archives (http://bnarchives.net). Research for this article was partly supported by the SSHRC. The article is licenced under Creative Commons (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Canada).
References
Albritton, Robert. 2009. Let Them Eat Junk. How Capitalism Creates Hunger and Obesity. London and New York: Pluto Press. Distributed in the United States of America exclusively by Palgrave Macmillan.
Baines, Joseph. 2014. Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy 19 (1, January): 79-112.
Diamond, Jared M. 2012. The World Until Yesterday. What Can We Learn From Traditional Societies? New York: Viking.
Essati, Majid, et. al. 2016. Trends in Adult Body-mass Index in 200 Countries from 1975 to 2014: A Pooled Analysis of 1698 Population-Based Measurement Studies with 19·2 Million Participants. The Lancet 387 (10026, April 2): 1377-1396.
Harrington, Michael. 1962. The Other America. Poverty in the United States. New York: Macmillan.
Harris, Marvin. 1989. Our Kind. Who We Are, Where We Came From, Where We Are Going. 1st ed. New York: Harper & Row.
Taken from here
Foto: Bernhard Weber
There is a fundamental biological difference between undernourishment and obesity: while hunger drives the undernourished to eat more if they can, there is no parallel instinct propelling the obese to eat less. On the contrary. The human body, having evolved during the long Palaeolithic epoch of hunting and gathering, craves salt, sugar and fat. But this very craving – which was necessary for survival in Palaeolithic times – became destructive once salt, sugar and saturated fat grew abundant (Harris 1989; Diamond 2012: Ch. 11). And because humans have limited natural defences against their own cravings, obesity is now an easier to inflict – and potentially more profitable – form of capitalized sabotage than undernourishment ever was. So, in the end, although undernourishment and obesity are biological opposites, they share a basic social similarity: they are both instruments of power.
Power in Hunger
Hunger has been a central lever of power throughout history. The earliest state civilizations of ancient Mesopotamia and Egypt were made possible, first and foremost, by the domestication of grains, particularly barley. The abundance of grains produced by the workers and slaves of these societies helped sustain a triangular complex of palace-temple-army, which in turn fed and provided for – as well as threatened, organized and ruled – their underlying propertyless populations. The central role of food in this process is imprinted all over the artistic carvings and drawings of these early societies: they portray their rulers as large, weighty and often overwhelming, while the ruled are shown as small, skinny and hunched over.
The Middle Ages too were organized around food. In the feudal regimes of Europe and Japan – as well in the empires of China, the princely states of India and the caliphates of the Middle East – the rulers controlled the land or its produce, and, by extension, the peasants who cultivated it. Their main threat was expulsion or extraction: for the tillers, being kicked off the land or deprived of its crops often meant hunger, privation and early death.
The transition to capitalism didn’t change the basic equation, at least not initially. The new liberal individual was obsessed with income and wealth; but the reason for this obsession was still the looming threat of poverty and hunger – the ultimate ‘scarcity’ of the capitalist universe. According to many, it was the permanent threat of hunger, amplified by a growing enclosure movement, that propelled the feudal population into the burgeoning cities, thus kick-starting urbanization and helping usher the Industrial Revolution. Hunger also anchored the classical political economy of Ricardo, Malthus and Marx, where the value of commodities was said to hinge on subsistence wages. And if we are to judge by the era’s novelists – from Balzac and Dickens to Hugo, Zola and Maupassant – the menace of hunger remained front and centre throughout the Victorian era. In the visual arts, the rulers, just like in antiquity, were portrayed as fat, healthy and long-living, while the ruled appeared underweight, sickly and ready to die.
Communism too was ruled by hunger. The Russian and Chinese revolutions were supposedly fought for human liberty and dignity. But as the communist masses were soon to learn, their new historically materialistic rulers – much like their divine predecessors – were particularly keen on leveraging the caloric intake of their subjects, usually to the latter’s detriment. Those who didn’t comply ended up in labour camps and other correctional facilities, where meagre portions of wheat and rice spelt want, sickness and doom – and all that while their rulers, generals and bureaucrats, like oriental despots, displayed their opulent bodies and multiple chins in official speeches and victory parades.
Twentieth-century capitalism promised an end to this spectre of hunger. The classical subsistence-wage labourer was replaced by a rational neoclassical ‘agent’. Having climbed out of poverty, the new ‘representative’ agent was no longer content with little food and shabby shelter; he or she became a ‘sovereign consumer’ determined to maximize his or her individual ‘utility’. Later on, with the spreading ritual of capitalization, the neoclassical agents were again remodelled – this time as walking ‘human capitals’ set on augmenting their ‘net worth’. The lives of these agents are still driven by ‘scarcity’, or so they are being told. They remain haunted by unlimited wants far exceeding their limited resources, and they still fight for ‘survival’. But unlike before, their fight now is said to be fuelled by the fervour of greed and the fear of being left behind, not by the threat of hunger and the prospect of extinction.
Power in Obesity
But this sea-change hasn’t eliminated food as a key lever of power. Far from it. Food is still a crucial form of social control – only that now it comes in a very different guise. Whereas until recently – and even today in parts of China, South Asia and Africa – the main threat for the underlying population was having too little to eat, nowadays it is having too much. The poor, traditionally punished by hunger, are now much more likely to be penalized by obesity.
This massive, ongoing transformation is reshaping the heart, mind and body of the capitalist subject. The undernourished, underweight, work-till-you-drop poor are gradually being replaced by their overfed, overweight, shop-till-you-drop descendants. And this inversion is hardly for the better. Although the adipose poor live longer than their scrawny predecessors, they are not necessarily healthier. They tend to suffer from non-communicable diseases – primarily diabetes, hypertension, strokes, cancer, heart attacks, atherosclerosis and other cardiovascular ailments (Diamond 2012: Ch. 11). And having been born into a hyper-capitalized complex of cheap industrial food, accessible pharmaceutical drugs and a highly intoxicating mass media, many of them are gradually losing their ability to control their inflating bodies and liberate their captured souls.
Ironically, this obesity revolution has been driven by wheat, rice, corn and potatoes – the very same crops that leveraged food power in the earlier hunger era. The plants that forced and lured hunters and gatherers into centralized state structures are now used – together with numerous supplements, both chemical and mental – to enslave capitalist subjects to their own irresistible cravings. And as the sedated, junk-food eating subjects become bigger and heavier, their previously ‘fat cat’ capitalist rulers eat organic, go to the gym and grow leaner and meaner. . . .
The Questions
There is nothing automatic, let alone natural, about this dialectic of food, poverty and power. The intertwined evolution of hunger and obesity is intimately connected to differential profit and accumulation. Both hunger and obesity represent complex levers of strategic sabotage, both get capitalized, and therefore both can be examined qualitatively and quantitatively. The capitalized dollar magnitude of this process – involving food, energy, pharmaceuticals, advertising and the mass media to the tune of trillions – makes it one of the key processes of modern capitalism, and therefore crucial to understand.
How has this remarkable hunger-to-obesity transformation evolved? What forms of capital drive the obesity epidemic, including its counter-movements of anti-obesity drugs, non-communicable disease treatments, diets, surgical fixes and psychological interventions? What are the material/ideal technologies that shift the world toward ever more destructive yet profitable forms of mass overfeeding? What policies and legislation have supported this shift, and how have they been imposed on the world’s population? And most importantly, what are the qualitative and quantitative links, if any, between these various strategies of sabotage on the one hand and differential profit and capitalization on the other?
Endnotes
[1] Shimshon Bichler teaches political economy at colleges and universities in Israel. Jonathan Nitzan teaches political economy at York University in Canada. All of their publications are available for free on The Bichler & Nitzan Archives (http://bnarchives.net). Research for this article was partly supported by the SSHRC. The article is licenced under Creative Commons (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Canada).
References
Albritton, Robert. 2009. Let Them Eat Junk. How Capitalism Creates Hunger and Obesity. London and New York: Pluto Press. Distributed in the United States of America exclusively by Palgrave Macmillan.
Baines, Joseph. 2014. Food Price Inflation as Redistribution: Towards a New Analysis of Corporate Power in the World Food System. New Political Economy 19 (1, January): 79-112.
Diamond, Jared M. 2012. The World Until Yesterday. What Can We Learn From Traditional Societies? New York: Viking.
Essati, Majid, et. al. 2016. Trends in Adult Body-mass Index in 200 Countries from 1975 to 2014: A Pooled Analysis of 1698 Population-Based Measurement Studies with 19·2 Million Participants. The Lancet 387 (10026, April 2): 1377-1396.
Harrington, Michael. 1962. The Other America. Poverty in the United States. New York: Macmillan.
Harris, Marvin. 1989. Our Kind. Who We Are, Where We Came From, Where We Are Going. 1st ed. New York: Harper & Row.
Taken from here
Foto: Bernhard Weber
Bemerkungen zu Anwar Shaikh`s „Capitalism: Competition, Conflict, Crises“ (5)

Eine Erhöhung der Nachfrage wird sich in erweiterter Produktion und/oder höheren Preisen ausdrücken, i.e. in einem nominal höheren Bruttobetrag. Die Wachstumsrate des BIP ist dann eine Funktion der neuen Kaufkraft in Relation zum BIP. Bei der Angebotsseite gilt es dann anzumerken, dass das reale Wachstum immer weiter abgedämpft wird, da die aktuelle Wachstumsrate nach und nach die maximale Wachstumsrate erreicht. Das deckt sich mit Keynes Aussage, dass bei Vollbeschäftigung die neue Nachfrage weniger durch den neuen Output absorbiert wird, sondern dass es zu Preiserhöhungen kommt. Diese Aussagen werden von Shaikh für seine Theorie der Inflation verwendet. Wenn das reale Wachstum positiv mit der Nettokaufkraft und Nettoprofitabilität (marginale Nettoprofitrate, Gewinn auf neues Investment) und negativ mit dem Grad der Ausnutzung des Wachstums korreliert und irgendwann einen kritischen Punkt erreicht, dann haben wir es bei der Relation zwischen beiden Momenten immer mit einer nicht linearen Funktion zu tun. Wenn die Inflationsrate gleich der Differenz zwischen der Wachstumsrate des nominalen und des realen Outputs ist, und die erstere eine Funktion der neuen relativen Kaufkraft ist, dann korreliert die Inflation positiv mit der neuen Kaufkraft und der Nettoprofitabilität und negativ mit dem ungenutzten Wachstum-Potenzial. Ein möglicher Fall der Nettoprofitabilität kann bis zu einem gewissen Grad durch einen Anstieg der Nachfrage kompensiert werden, sodass die Wachstumsrate weniger stark als die Profitrate fällt. Ein Fall der Wachstumsrate führt zur Arbeitslosigkeit, während der Anstieg der Wachstums-Kapazitätsrate die Ökonomie inflationsanfälliger macht. Das ist das Geheimnis der Stagflation. Dabei können die Raten nur innerhalb bestimmter Grenzen variieren, aber in einem System mit Fiatgeld gibt es anscheinend keinerlei Grenzen für das Wachstum der Kaufkraft. Wenn die Rate des Anstiegs der Kaufkraft relativ niedrig ist, dann ist der Einfluss auf die Inflation noch gering, bei hohen Raten wird das anders. Somit lässt sich die Inflation als eine Funktion der neuen Kreditaufnahmen (Nachfrage durch Konsumentenkredite), der Nettoprofitabilität und dem Grad der ungenutzten Kapazitätsauslastung definieren. Empirisch kann man heute eine starke Relation zwischen dem Kreditwachstum und dem Wachstum des nominalen BIP registrieren, wobei an den Peak Points das Wachstum de BIP geringer als das der Kredite ist, was ein Zeichen dafür ist, dass die gestiegene Nachfrage zu einer Inflation der Wertpapier- und Anleihepreise und zu Währungsspekulationen führt.
Shaikh begreift die Krise von 2007 als die erste große Rezession im 21.Jahrhundert, die sich wie alle großen Krisen durch einen finanziellen Kollaps und im Fall der USA durch die Subprime-Krise angezeigt hat. Aber das war für Shaikh nicht der eigentliche Grund der Krise. Shaikh untersucht zur Krisenbestimmung zunächst die langen Wellen; dabei geht er von drei bis fünfjährigen Zyklen aus, die auf das Inventar abgestimmt sind, von sieben bis zehnjährigen Zyklen, die auf das fixe Kapital bezogen sind, und von längeren strukturellen Zyklen. Alle diese Zyklen sind von beschleunigter und entschleunigter Kapitalakkumulation durchzogen. Die große Depression der 1930er Jahre zeichnete sich durch hohe Arbeitslosigkeit und Preise aus, bei der Stagflationskrise in den 1970 Jahren gab es als Resultat der keynesianischen Politik eine gegenüber der großen Depression halbierte Arbeitslosigkeit und hohe Inflationsraten zu vermelden. Ab den 1980er Jahren haben wir es mit einem neuen Boom zu tun; eine permanent niedrige Zinsrate erhöhte die Nettogewinnrate auf das Kapital (die Netto-Differenz zwischen Zinsrate und Profitrate). Fallende Zinsraten führten zu einer weit gestreuten Verteilung des Kapitals auf dem Globus und zu einem Anstieg der Konsumentenkredite und schließlich zu sich verstärkenden Finanzkrisen und Bubbles. Gleichzeitig gab es die neoliberalen Attacken auf die Reallöhne, die im Verhältnis zur Produktivität sanken. Der Fall der Zinsraten und der Reallöhne führte zu einem Anstieg der Nettoprofitraten. Normalerweise hätte dies zu einer Stagnation der Konsumnachfrage führen müssen, aber durch den Fall der Zinsrate konnten in enormen Ausmaß Konsumentenkredite vergeben werden, und so stieg die Konsumnachfrage aufgrund der Verschuldung bis zur großen Krise weiter an. Die Antwort des Kapital auf die Stagflation der 1970er Jahre war also ein Angriff auf die Reallöhne und die drastische Absenkung der Zinsraten, was eine positive Auswirkung auf die Nettoprofitraten hatte. Hier liegt für Shaikh das Geheimnis des Booms seit den 1980er Jahren. Aber dieser Boom war inhärent inkonsistent. Die Ausweitung einer billigen Finance führte zu hohen Verschuldungen in allen Sektoren der Wirtschaft, insbesondere kompensierten die Haushalte das Sinken der Reallöhne mit der Aufnahme von Konsumentenkrediten.
Empirisch untersucht Shaikh dann die großen Kondratieff-Wellen von 1790 bis 2010 in den USA und Großbritannien (der Preislevel wird auf Gold bezogen). Fast immer beginnt eine Krise in der Mitte der Abwärtsbewegung dund für Shaikh macht die Rezession von 2007 hier keine Ausnahme. Generell hat die technologische Innovation einen negativen Einfluss auf die normale Profitrate, was aber in der neoliberalen Periode durch fallende Reallöhne so weit kompensiert wird, dass zumindest der Fall der maximalen normalen Profitrate aufgehalten werden kann. Die durchschnittlichen Nettoprofitraten und die marginalen Profitraten sind strukturell auf die Kombinationen der Pfade der Profitraten und der Zinsraten bezogen.
Die wenigen Bemerkungen Shaikhs zu Pikettys einflussreichem Bestseller „Das Kapital im 21.Jahrhundert“ führen hin zur Debatte über das Problem des Falls der allgemeinen Profitrate. Eine der zentralen Thesen in Pikettys Buch ist die, dass im Kapitalismus eine Tendenz zu einer Steigerung der Vermögens- und Einkommensungleichheit stattfindet (die nur durch die beiden Weltkriege, Revolutionen und Depressionen unterbrochen wurde), sodass diejenigen, die vom Einkommen aus Vermögen und Renditen leben, schneller als die Lohnabhängigen akkumulieren. Zudem tendiert die Kapitalrendite/Profitrate (r) dazu, die gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate (g) zu übersteigen, wobei Piketty betont, dass r > g eine empirische Tendenz sei, aber eben keinesfalls determiniere.
Pikettys Untersuchungen basieren weitgehend auf den Ergebnissen der neoklassischen Ökonomie, das heißt der Existenz aggregierter Produktionsfunktionen und der Aussage, dass die Profitrate durch das marginale Produkt des Kapitals determiniert wird, und das letztere fällt, wenn der Kapitalstock ansteigt. Allerdings ist die Annahme einer aggregierten bzw. gesamtwirtschaftlichen Produktionsfunktion sowie die Existenz einer definierten Menge an Kapital unabhängig von der Bestimmung der Preise der heteorgenen Kapitalgüter und der Profitrate nicht denkbar. Dabei müssen die Preise der heterogenen Kapitalgüter bekannt sein, um einen gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock zusammenzufassen zu können. Wie Sraffa nachgewiesen hat, sind die Preise der heterogenen Kapitalgüter ohne die Kenntnis der Profitrate nicht bestimmbar, ergo müssen hier die Preise der Kapitalgüter und die Profitrate simultan bestimmt werden.
Piketty berechnet den Profitanteil als Produkt der Profitrate und der Kapital-Einkommensrate. Über die Zeit fällt die Profitrate, weil das marginale Produkt des Kapitals aufgrund des Anstiegs des Kapitalstocks fällt, sodass es eines Anstiegs der Kapital-Einkommensrate bedarf, um den Fall der Profitrate zu bremsen. Eine fallende Profitrate kann also durch eine steigende Kapital-Einkommensrate ausgeglichen werden, sodass es hier tatsächlich auf den Einsatz von Technologien ankommt. Piketty beobachtet empirisch einen Anstieg der Profitquote und des Kapital-Einkommens-Verhältnisses, wobei er eine CES-Produktionsfunktion mit einer Substitutionselastizität größer als eins annimmt; wird eine CES-Produktionsfunktion mit einer Produktionselastizität ungleich eins verwendet, dann übt die Kapitalintensität einen Einfluss auf die Höhe der Einkommensquoten aus.
Für Shaikh lässt sich von empirischer Seite die Einkommensungleichheit mit dem Verhältnis der Rate der Einkommen aus Renditen zu den Lohneinkommen erklären, das er klassischerweise auf die Teilung des Werts in Löhne und Profite und auf den Grad der daraus resultierenden Finanzialisierung der Einkommensströme zurückführt. Auf der theoretischen Seite wird der Lohnanteil durch die Arbeitslosenquote und dem Verhältnis zwischen dem Machtanteil „Kapital versus Arbeit“ und dem Profitanteil definiert; die Rate der Kapitalauslastung wird durch die Wahl der Techniken determiniert, die wiederum auf den Imperativ der Kostensenkung bezogen bleibt, dem die Unternehmen qua Konkurrenz unterworfen sind. Die Profitrate wird durch beide Aspekte bestimmt. Dabei ist die normale Profitrate immer höher als die normale Wachstumsrate, da die erstere die Rate des Surplus zum Kapitalstock beinhaltet, während die letztere die Reinvestition des Anteils des Surplus zum Kapitalstock umfasst. In Shaiks Position ist die Profitrate das Vrhältnis der Rate des Profitanteils zur Kapitalintensität, wobei ein Anstieg der letzteren ein wichtiger Grund für den Fall der Profitrate ist. Die Profitrate bestimmt die Zinsrate und die Differenz der beiden Raten bestimmt die Wachstumsrate.
Piketty subsumiert unter die Lohneinkommen Gehälter und Löhne, aber auch Transferleistungen, Arbeitslosengeld sowie Einkommen aus Aktien, Wertpapieren etc., während die Einkommen aus Vermögen Profite, Zinszahlungen, Renten, Royalties, Immobilien und finanzielle Instrumente umfassen. Shaikh hält insbesondere Pikettys Messung der Profitrate für inkonsistent, weil dieser im Nenner den Kapitalstock anführt, der aber nicht nur Equipment, Maschinen und Fabriken, sondern auch Land, Immobilien und finanzielle Assets (Netto) umfasst, während im Zähler Renten, Zinszahlungen, Gewinne auf finanzielle Assets und Liquidationsgewinne ausgeschlossen werden. Deshalb fällt bei Piketty die Profitrate im Boom nach den 1980er Jahren. Für Shaikh handelt es sich, wenn die finaziellen Assets im Nenner der Profitrate aufgeführt werden, um Doppelzählungen. Dies halten wir weniger aufgrund der Aussagen Pikettys, sondern der Erläuterungen von Alan Freeman für unkorrekt.
(Das Problem mit Piketty ist noch ein anderes, denn seine Definition des Kapitals behandelt dieses wie ein Ding und nicht als einen Prozess, in dem aus Geld Mehrgeld wird. Piketty definiert das Kapital als den Stock aller Assets, die von Unternehmen, dem Staat und Haushalten gehalten werden und am Markt gehandelt werden können, egal ob sie eingesetzt werden oder nicht. Dies inkludiert Immobilienbesitz, Eigentumsrechte und bspw. Kunstbesitz. Um hier eine Gewinnrate r anzunehmen, muss man das Ausgangskapital irgendwie bewerten. Es kann nur im Kontext der Produktion, der Profitrate und der Marktpreise bewertet werden. Für die Neoklassik, auf die sich Piketty hier bezieht, beruht die Rate des Gewinns auf Kapital auf der Wachstumsrate, weil das Kapital durch das definiert wird, was es produziert und nicht durch das, was in seine Produktion eingeht. Geld, Boden, Immobilien und Equipment sind, wenn sie nicht produktiv eingesetzt werden kein Kapital. Entscheidend bleibt hier die Profitabilität bzw. die Profitrate.)
Fast alle Marxisten benutzen im Zähler und Nenner der (allgemeinen) Profitrate den Unternehmensgewinn und den fixen Kapitalstock als Annäherung an den Surplus und das eingesetzte Kapital. Fred Moseley bspw. behauptet, dass der Unternehmensgewinn im nicht-finanziellen Sektor die entscheidende Kennziffer sei, wobei er von den Unternehmensgewinnen die Gewinne aus dem sog. unproduktiven finanziellen Sektor und dem des Handelskapitals abzieht. Shaikh argumentiert, dass der Unternehmensprofit (die Gewinnrate des industriellen Investments nach Abzug aller anderen Forderungen auf Profit) diejenige Größe sei, die für die Investmententscheidungen relevant sei. Es gibt Auseinandersetzungen darüber, ob die Netto- oder Bruttoprofitrate für die Messungen der Profitrate bzw. die Profite vor oder nach Abzug der Steuern relevat ist. Kliman fordert die Messung der fixierten Assets nach historischen und nicht nach aktuellen Kosten.
Alan Freeman fordert (insoweit also finanzielle Instrumente berücksichtigt werden, hier mit Piketty konform), das nur sog. fixed Assets im Nenner der allgemeinen Profitrate berücksichtigt werden sollten. Der Wert des verausgabten Kapitals ist aber in den Phasen des Kapitalkreislaufs nicht nur in Maschinen, Rohstoffen, Energien und Anlagen gebunden, sondern auch in Geldbeständen und Vorräten sowie in finanziellen Investitionen. Geld unterscheidet sich in dieser Hinsicht nicht von unverkauften Waren, dem Inventar und dem Kapitalstock. Was passiert nun mit der Profitrate, wenn die handelbaren finanziellen Instrumente im vorgeschossenen Kapital bzw. im Nenner der Profitrate enthalten sind? (Natürlich sind auch die Gewinne auf finanzielle Assets im Zähler der Profitrate anzuführen.) In den USA und UK haben wir es dann laut Freemans eigenen empirischen Analysen - entgegen der Annahmen Shaikhs - auch seit den 1980er Jahren mit einem Fall der Durchschnittsprofitrate zu tun.
Finanzielle Firmen funktionieren nicht ohne Kapital, und dies ist Geldkapital. Sie benötigen Kapital im „physikalischen“ Sinn (Maschinen, Computer, Gebäude, Software etc.) und Arbeitskräfte, aber ihre wichtigsten Assets sind Geldsummen oder handelbare finanzielle Instrumente, die gegen Geld getauscht werden können: Dies können Reserven sein, Währungsbestände, Bonds oder Derivate – die Bank benutzt sie, um Profit zu erzeugen, sie sind ihr Kapital. Sie sollten deshalb im Nenner der (allgemeinen) Profitratte enthalten sein.
Generell gehen wir in Absetzung von Shaikh davon aus, dass sich Kapital und Finance in verschiedenen Art und Weisen überlappen bzw. superponieren. Finance ist heute die maßgebende Form des Kapitals. Veränderungen im Verlauf der Profitraten haben Konsequenzen für die Entwicklung der Finance, aber diese sind nicht unidirektional und sie transformieren auch nicht die Funktionsweisen der Finance. Finance ist heute mehr als die Akkumulation von Verbindlichkeiten und ansteigende Verschuldung. Sie beinhaltet ein steigendes Investment in Forschung und finanzielle Innovation und basiert auf institutionellen Entwicklungen, ökonomischen Strategien und staatlichen Regulationen, die alle ihre eigene Geschichte und Temporalität besitzen. In diesem Sinne kann die Geschichte und Struktur der Finance nicht auf eine Spiegelung der historischen Patterns der Profitrate reduziert werden. Die Entwicklungen der Finance vollziehen sich nicht zeitgleich und/oder symmetrisch mit den Verläufen der Profitraten.
Foto: Bernhard Weber
The Forces of Reproduction

Saal 6 – 10

Why IPE Needs to Talk about Money: On Austerity, Financial Power, and Debt

the world is awash in debt and though we should recognise that debt levels and access to credit are radically unequal within and between countries, the commonality of all modern political economies is not so much that they are market oriented but that they are all debt based political economies. Indeed, as Rowbotham noted: ‘the world can be considered a single debt-based economy’ (1998: 159). To take an international perspective, according to the global management consulting firm McKinsey and Co., as of 2012 the total outstanding debt across 183 countries was US$175 trillion (Update: it’s now US$199 trillion as of a 2015 McKinsey Report). In 1990, the same figure was only US$45 trillion or a 288% increase over the period. As identified in Table 1.1, all categories of debt have increased considerably with government debt, financial industry debt and securitised debt (e.g. mortgages, commercial real estate) leading the categories by percent increase. Table 1.1 (2012 dollars)This fact not only has implications for growing inequality and the rise of the 1% and billionaire class. As many of us are aware in IPE, the fear of ballooning public debts is virtually always the perennial justification for neoliberal austerity politics. It seems that almost everyone is living beyond their means but the bankers and the 1%. But when we critically examine how new money enters the economy, the need for neoliberal austerity policies should be understood as a political choice rather than one that is historically inevitable by some iron law of debt and public spending. These policies (privatisation, fiscal discipline, deregulation, cutbacks, layoffs, user fees, more indirect taxes, tax cuts for the wealthy, etc…) also tend to cause incredible damage to the livelihoods and well-being of ordinary people, not to mention the most vulnerable. So why are neoliberal austerity policies a political choice rather than a historical necessity? The story in brief, drawing from Debt as Power and the additional work to come, can be told as follows. First, let us consider the simple fact that there is considerable mystery when it comes to understanding money and specifically how new money enters an economy. It is highly likely that our politicians do not have a clear understanding of monetary mechanics and are themselves beholden to ‘received truths’ passed down by generations of faulty or misleading scholarship – particularly in Economics where money is treated as unimportant and a neutral veil. In our view, money and particularly the production of it, is far from neutral and involves perhaps the most important power relationship in capitalism (see the seminal and vastly understudied work of Geoffrey Ingham, The Nature of Money). So our first point is that we are governed by politicians who likely have: 1) no understanding of how money enters the economy or 2) have a faulty, muddled or outdated understanding of how new money enters the economy. As it turns out, this is an excellent situation for the private social forces that actually do own and control how new money enters the economy. Our money supply, as it were, is capitalised by the owners of commercial banks. So now, let’s take a closer look at how new money actually does enter an advanced capitalist economy like the United States. Many would be surprised to find out that the vast majority of the money supply in leading capitalist countries (we have focused on the US and UK in our research) is issued by commercial banks when they make loans – over 90% in most advanced capitalist economies. Most of this money does not consist of notes and coins, but numbers in computers organised by double-entry bookkeeping. This form of bookkeeping is an historical creation that has been naturalised and taken for granted rather than critically examined for its effects. But now is not the time to take double-entry bookkeeping to task. Let’s focus on why the fact that banks create money is crucial for understanding neoliberal austerity policies as a political choice rather than a product of some iron law that must be followed to the letter. The important point is this: most people assume that banks are intermediaries. That is, they take money in from savers and because it is assumed the savers don’t need their money right away, the bank is able to lend some of this money at interest to willing borrowers. This view is completely wrong. In reality, when banks make loans to willing borrowers – individuals, businesses and governments – they are creating new money as deposits in the accounts of their customers. For example, if I take out a loan or a credit card for US$10,000, the bank records this as a liability (they owe me this credit facility) on their balance sheets. To offset the liability side of the balance sheet, they record my promise to pay (remember, we sign a contract for loans and credit cards) as an interest bearing asset. The contract is the bank’s asset and the loan/deposit, the bank’s liability. This has been confirmed by the recent work of Josh Ryan-Collins et. al., Where Does Money Come From?. It should also be noted that Post-Keynesians and neo-chartalists have also recognised endogenous money but have oddly never problematised the fact that banks create new money when they issue loans. While this research has hardly caused a dent in mainstream or popular thinking across the world, even Martin Wolf of the Financial Times had to recognise the glaring facts in a 2014 article. What this means is that our democracies have relegated the power to create new money to privately owned (though publically traded) commercial banks (with a key role for central banks of the world not discussed here). There is a rich history of how this arrangement came about and we explore this in our work, but the key point to emphasise in this blog post is that if our governments want to spend more money than they take in in taxes, fees and fines, they are structurally forced to borrow at interest. There is no legitimate reason why this has to happen, but there is a historical one and it has to do with power, inequality and ultimately a very tiny minority getting something for nothing. Put simply, there is a structural reason why the collective ‘national’ debts of the world’s governments currently stands at US$ 58 trillion and counting according to the Economist’s debt clock.But the concept and prevalence of debt in capitalist modernity needs to be critically theorised. Our starting point, and primary argument, is that debt within capitalist modernity is a social technology of power and its continued deployment heralds a stark utopia. Our claim is not that debt can be thought of as a technology of power but rather that debt is a technology of power. By technology we simply mean a skill, art or manner of doing something connected to a form of rationality or logic and mobilised by definite social forces. In capitalism, the prevailing logic is the logic of differential accumulation and given that debt instruments far outweigh equity instruments, we can safely claim that interest-bearing debt is the primary way in which economic inequality is generated as more money is redistributed to creditors.
Type of Debt 1990US $Trillion 2012US $Trillion Percent Increase Government Bonds 9 47 422% Financial Bonds 8 42 425% Corporate Bonds 3 11 267% Securitized-Loans 2 13 550% Non-Securitized Loans 23 62 170%
 So the question now becomes who are our governments borrowing from? As it turns out, there are five major sources: 1) individuals/families who purchase government debt as a safe investment – typically through a financial vehicle and/or intermediary; 2) non-financial corporations can place surplus cash in government interest bearing securities; 3) foreign governments and corporations; 4) domestic commercial and central banks; and 5) government entities.
But of these five options, it is only the domestic commercial and central banks that have the power to create money for the purpose of purchasing government securities. In other words, whereas the other four options involve investing money that is already in existence, when domestic commercial and central banks purchase government securities they do so by creating the money and expanding their balance sheets accordingly. Effectively, this means that the owners of commercial banks are getting something for nothing.
So the question now becomes who are our governments borrowing from? As it turns out, there are five major sources: 1) individuals/families who purchase government debt as a safe investment – typically through a financial vehicle and/or intermediary; 2) non-financial corporations can place surplus cash in government interest bearing securities; 3) foreign governments and corporations; 4) domestic commercial and central banks; and 5) government entities.
But of these five options, it is only the domestic commercial and central banks that have the power to create money for the purpose of purchasing government securities. In other words, whereas the other four options involve investing money that is already in existence, when domestic commercial and central banks purchase government securities they do so by creating the money and expanding their balance sheets accordingly. Effectively, this means that the owners of commercial banks are getting something for nothing.
The state creditors actually give nothing away, for the sum lent is transformed into public bonds, easily negotiable, which go on functioning in their hands just as so much hard cash would…. It was not enough that the bank gave with one hand and took back more with the other; it remained, even whilst receiving, the eternal creditor of the nation…And indeed, because our governments have been structured historically not to create money (with the exception of notes and coins in most instances), the public is forced to go into debt to private social forces. But the big question is whether this has to be the case? Why shouldn’t our democratically elected governments have the power to create interest free money rather than enter a debt relationship with private social forces who capitalise the production of money at interest? This latter process, as we have seen, leads to mounting ‘national’ debts, the primary justification for the policies of neoliberal austerity. Of course, because of years of misleading propaganda on the riddle of inflation combined with the popular denigration of public servants and institutions (stronger in some countries than in others) many would react in horror to the proposal that governments should be in control of the production of new money. There are undoubtedly real and perceived challenges to overcome when considering sovereign money but the alternative is to let the bankers continue to create new money out of thin air and profit from the interest. But there are indeed proposals to create sovereign or public money that avoids inflation and at their centre are two simple propositions: 1) money should be produced interest free and in a planned and democratic way; and 2) this new money should be spent on productive activities that benefit society and urgently address climate change and the need for renewable energy among defeating other unnecessary social ills like homelessness, poverty and hunger. If you think that this is impossible, consider the fact that Switzerland will be holding a referendum on whether to stop private banks from creating new money while putting the control of new money creation solely in the hands of the Swiss National Bank. The elected government will then instruct the Swiss National Bank how it should spend new money into the economy, closely monitoring the effects of new money creation. Today, much of the new money created by banks has gone into speculative asset inflation, particularly in real estate and the stock markets of the world. And this brings us to some of the key consequences of allowing commercial banks to issue the majority of the money supply and to charge interest for it. We can list them as follows:
- Democratic governments are not in control of most of their money supply and are structurally forced into debt to a minority of private social forces who profit from this relationship. The fact that the state has the power to tax the population allows for private social forces to capitalise on this power process and direct a stream on income to themselves through government securities. As Creutz pointed about long ago, it is a mathematical certainty that due to the ownership of government securities (the minority) and the payment of taxes (the majority) more money will be received by the minority of the bondholders from the majority of taxpayers. See also the forthcoming book from Sandy Brian Hager on Public Debt, Inequality and Power in the United States of America;
- While governments do set spending, distribution and allocation priorities based on a budget, it is largely commercial banks that set allocation/distribution priorities for society given that they are the primary institutions of new money creation. Banks need not create money for productive purposes and can create money to speculate on securities and real estate;
- There is always more debt in the system than the ability to repay. This is because when banks create loans they do not create the interest. For example, a US$100 dollar loan at 10% interest will mean that the borrower has to repay US$110 to discharge the loan. But the bank creates only US$100, not US$110. The money has to be obtained from elsewhere, which is also a key trigger for the need for economic growth and the greater commodification and monetisation of nature;
- The sabotage of the possibility of public or sovereign money and the private ownership of the capacity to create new money leads to an inevitable need for credit/debt when incomes do not meet spending expectations or a desired lifestyle. For example, most people are forced into debt if they want to buy a home or car. But as Susanne Soederberg points out in her wonderful book Debtfare States, many low income groups have been turning to consumer credit just to make ends meet; and
- Money/debt is based on creditworthiness and tied to assets and income, hence the already rich can borrow more money, leading to greater inequality. For example, hedge fund managers can typically leverage their assets by about ten times, meaning if they have assets of US$1 billion, they can borrow another US$10 billion from commercial banks to speculate on income-generating assets. We have to recall that a 5% return on US$10 billion is far greater than a 5% return on US$ 1 billion! Hence, the proliferation of hedge fund billionaires;
- The owners of banks essentially profit from a fraud. Fraud is typically understood to be a deliberate deception in order to secure an unfair gain or advantage. Since the banks create new money and do not act as intermediaries between savers and borrowers, they are indeed deceiving the public and certainly are securing unfair financial gains. There is a reason why the banking sector is the most heavily capitalised sector of the global economy each year and that an orgy of bonuses and luxury spending follows each fiscal year. See below:

- Interest on money/debt is a key driver of differential inflation. Interest is a cost to business and gets pushed on to consumers. So consumers not only pay for the base costs of a good or service, but also a portion of the interest the business owes to the banks as well as whatever mark-up on costs the business feels it can get away with. This is interest inflation and profit inflation. Just so that we’re clear that most businesses to do not finance their expansions out of their retained earnings, here’s the level of non-financial corporate debt in the United States (and we assume a similar trajectory in capitalist economies):

- Government fiscal policy is incredibly important and has more to do with monetary policy than the monetary policy of central banks – which basically regulates the inter-bank market. This is so because should an economy stagnate with low or negative growth and high unemployment then it is only the government that can help create effective demand by spending into the economy. The only problem with this solution is that, at present, thanks largely to Keynes’ denial of sovereign money, governments are forced into debt at interest to do so when they need not be;
- There is another consequence for entrepreneurs who may have a great idea but not enough money to invest in their business to make it viable. Since banks typically do not lend to new small businesses without collateral or some other guarantee, this means that entrepreneurs have to turn to venture capitalists and the like for an investment and therefore give up equity in their companies; and
- We need to abandon the notion that savings lead to investment. This is false. No saving has to take place before new money can be issued. Furthermore, more saving means less money in an economy, not more.
Paul P. Preciado und das pharmapornographische Regime

Dieser Artikel beansprucht keine umfassende Darstellung (und Kritik) des gerade in deutscher Sprache erschienenen Buchs „Testo Junkie“ von Paul B. Preciado, sondern beschreibt lediglich die basic facts des sog. pharmapornographischen Regimes. Auf NON hat Alexander Galloway zu den Fragen des Widerstandspotenzials einer queeren Ontologie und Differenzphilosophie, in deren Umfeld sich auch Preciado bewegt, Stellung genommen. Gender bleibt für Galloway eine Idee, die auf einem naiven Universalismus basiert und ein imaginäres Zentrum besitzt. McKenzie Wark hat wiederum in seiner umfassenden Besprechung von "Testo Junkie" darauf hingewiesen, dass es sich bei diesem Text um etwas handele, das Lyotard „Libidinöse Ökonomie“ genannt habe, eine Ökonomie, die heute auf der digitalen und molekularen Ebene funktioniere, um Sex, Geschlecht und Subjektivität postindustriell zu produzieren. Dabei stehen Pharma- und Pornoindustrie innerhalb der postfordistischen Kapital-Ökonomie in Opposition zueinander wie sie auch zusammenarbeiten. Geschlecht und Sex mutieren laut Preciado zu Komponenten biopolitischer Regulationen und zu Produktionen des Technokapitalismus, der globalen Medien und des Internets. Einige Komponenten des sog. pharmapornokologischen Kapitalismus wollen wir hier zusammenfassen.
Die Zeit des kalten Krieges markiert laut Preciado eine intensive Phase der endokrinologischen Experimente, die in der Antibabypille als dem bis heute am meisten verwendeten Molekül in der menschlichen Geschichte münden, und dies darf als ein wichtiger Ausgangspunkt der postindustriellen Regulierung von Pornographie und Prostitution durch Staat und Ökonomie gelten. In den 1960er Jahren wurde die Pille von weißen amerikanischen Medizinern, deren eugenisches Interesse nicht zu unterschätzen war, bestimmten proletarischen Frauen in Puerto Rico verabreicht, um die Geburtenraten der rassifizierten Anderen zu kontrollieren. Die Geburtenrate fiel dann tatsächlich auch in rekordverdächtiger Zeit. Ein paar Jahre später war die Pille in den USA verfügbar und wurde als ein Instrument vermarktet, dass es Frauen ermöglichen sollte, ihre eigenen Körper zu kontrollieren, ja sogar zu befreien. Preciado sieht hier aber eher (mit Foucault) das biopolitische Versprechen einer Governance von freien Körpern realisiert. In der Pille sieht sie ein neues Paradigma der Subjektkonstitution der Frau, deren Körper durch die Einnahme biologisch rekonfiguriert und einem strikt zeitlich durchgeführten hormonellen Management unterstellt wird, eine spezifische Form des Körperdesigns, das wiederum sexuelle und kosmetische Aktivitäten der Frauen programmiert. Die Pille fungiert als ein Kontrollinstrument zur Regulierung der Bevölkerung als auch zur Normalisierung der weiblichen Sexualität.
In die Zeit des kalten Krieges fällt auch die Erfindung des Begriffs „Cyborg“, der im Kontext von Weltraumprogrammen einen technisch ausgerüsteten Organismus beschreibt, der in einem Milieu außerhalb der Erde als ein gleichgewichtiges homöostatisches System überleben kann. In dieser Zeit wurde die Entwicklung des Kunststoffs und des Plastiks (Polymerisation von Kohlenstoffketten) vorangetrieben, was zu einer neuen ökologischen Transformation der Erde mit einem bis heute ansteigenden Vergiftungsgrad führt. Die aus all diesen Prozessen resultierende Subjektivität ist das Resultat bio-molekularer Kontrolle und technisch-statistischer Protokollierung. Preciado fasst zusammen: “Unsere globale Ökonomie ist von der Produktion und Zirkulation riesiger Mengen synthetischer Stereoide abhängig, von technisch transformierten Organen, Flüssigkeiten, Zellen (techno-Blut, techno-Sperma, techno-Ovarien, etc.), von der globalen Verbreitung pornographischer Bilder, der Entwicklung und Verbreitung neuer legaler und illegaler synthetischer psychotroper Substanzen (Lexomil, Special K., Viagra, Speed, Ecstasy, Poppers, Heroin, Omeprazol...), von Zeichenströmen und digitalen Informationskreisläufen, der totalen Ausweitung diffuser urbaner planetarischer Architektur, in denen die Ghettos der Megacities an Knotenpunkte hochkonzentrierten Sex-Kapitals grenzen.“ (Preciado 2016: 35) Diesen global-medialen und postindustriellen Komplex nennt Preciado das „pharmapornographische Regime“, das im Zuge von molekularen und semiotechnischen Modulationen ein differenziertes technoides Subjekt generiert. Dieses Regime ist ein Designer-Regime, insofern mittels des Designs spezifische Körpertechnologien und technoide Relationen zwischen Körpern, Raum und Zeit hergestellt werden. Die Körper und das Leben werden zunehmend durch Drogen, Hormone und Moleküle reguliert: Sex und Fortpflanzung; Arbeit, Freizeit und Schlaf; das äußere kosmetische Design und die psychischen Stimmungen. Das semiotechnische Regime ist hingegen pornographisch; es umfasst die Sexualität, installiert ein hegemoniales Bildregime und okkupiert heute die gesamte Kulturindustrie. Während die Pharmaindustrie die Produktion der Pille, Prozac und Viagra betreibt, produziert die Pornoindustrie eine korrespondierende Liste der Blowjobs, der Penetrationen und der Stellungen. Die Bio-Wissenschaften verkoppeln in einer Art performativen Bio-Feedback synthetische Produkte mit psychischen Zuständen (Depression und Prozac; ADHS und Ritalin) und mit Geschlechtsdynamiken (Testesteron, Vigara und Maskulinität; Fruchtbarkeit, Kosmetik und Pille). Zwar produziert das Pharma-Porn-Kapital ständig neue Objekte, aber sie dienen nur als Stützen für das Subjekt. Die Produktion der Dinge und Ideen, der Organe und Zeichen, der Hormone und der Seele befördern die Kreation des postindustriellen Subjekts. Die Psyche und der Sex werden technologisch designt; es entsteht keineswegs ein kohärentes Subjekt, sondern ein durchlöchertes System, dem man Pillen und Schwänze in den Mund steckt, Dildos steckt man in die Vaginas, Silikon setzt man in die Brüste ein oder man entnimmt Haut und Fett, um neue Organe und Prothesen herzustellen. Zwar können mit diesen Technologien Geschlechtsbinaritäten in Frage gestellt werden, aber zugleich werden diese Binaritäten auch wieder festgeschrieben. Das Pharma-Porn-Kapital produziert geradezu einen Naturalismus des Sexes und des Geschlechts, indem man Technologien entwickelt, die dieser Idee näher rücken. Preciado spricht sich nicht prinzipiell gegen einen solchen Techno-Körper aus, dem vielleicht ja ungeahnte Potenziale innewohnen, sondern sie polemisiert gegen die eigenartige Kapitalisierung und gegen die spezifische Kontrolle und Produktion dieses Körpers. Das Signum der biopolitischen Produktion, wie Foucault sie bezeichnet hat, ist das der Zeichen, der Symbole und der Information sowie der Affekte, und zwar nicht der persönlichen Affekte, sondern der systematischen Effekte, welche sie produzieren.
Eine wichtige Komponente der heutigen Informationsökonomie stellt für Preciado die pornographische Industrie dar (ca. 1,5 Millionen Webseiten im Internet, die für den Umsatz von ca. 14 Milliarden Dollar pro Jahr mitverantwortlich sind). Das Internet und die pharmapornologische Industrie produzieren heute im Verbund eine differenzierte Kontrolle des weiblichen Körpers, während die ejakulatorische Funktion des männlichen Körpers zunehmend ins Blickfeld der Techno-Ökonomie gerät. Das ökonomische Modell der Pornoindustrie beinhaltet für Preciado die masturbatorische Logik des Konsums, das heißt minimale Investition, Echtzeit-Verkauf und Echtzeit-Konsum des Produkts, möglichst hoher Profit. Angetrieben werden Porno- und Pharmaindustrie durch eine Arbeit, die im Kreislauf Erregung-Frustration-Erregung permanent moduliert wird, i.e. durch Erektion, Ejakulation, Lust, Masturbation, Kontrolle und Destruktion. Die Produkte sind Techno-Sex Körper, wobei der Sex selbst und die semiotechnischen Informationen wichtige Ressourcen und Waren für das postfordistische Kapital darstellen. Es geht hier immer auch um das Mapping der Kapitalökonomie, das auf dem Management der Körper, des Sexes und der Identitäten beruht, oder dem, was Preciado das “Somatico-Politische” nennt - das Sex-Geschlecht des industriellen Komplexes, dessen wichtigste Objekte synthetische Steroide, Porno und Internet sind. Dies generiert eine ubiquitäre pharma-porno-punk Hypermodernität.
Analog zur Automobilindustrie im Fordismus müsse man heute, so Preciado, von der Pharmapornographie als dem wichtigsten Element der postfordistischen Ökonomie sprechen. Entscheidend für diese Dominanz seien aber nicht die quantitativen Umsätze, sondern der Fakt, dass die Pharma-Porn Modelle, die sich aus masturbatorischer Logik und dem Kreislauf von Erregung und Frustration zusammensetzen, grundlegend für alle anderen Arten der Produktion gälten. Die Arbeitskraft der klassischen Ökonomie sei in eine (aktuelle und virtuelle) orgasmische Kraft, die „potentia gaudendi“, umgewandelt worden. Ganz spinozistisch definiert Preciado jenseits der Frage der Geschlechts- und Organzugehörigkeit diese psychische und somatische Kraft als ein unendliches Vermögen, das die gesamte Welt in Genuss übersetzen wolle, oder, um es anders zusagen, in die Kapazität, erregt zu sein oder zu erregen, erregend zu sein und mit jemandem erregt zu sein. Das Kapital verdient und verführt, indem es die sexuellen Ressourcen dieser Kraft in Arbeit verwandelt. Damit versucht das Kapital die potentia guadendi zu privatisieren und sie in Form der Produktion von Molekülen (Pharma) und von pornographischen Zeichen und Sexdiensten produktiv zu machen. Preciado behauptet weiter, dass diese Kraft - Ereignis, Werden oder Praxis, fleischlich und doch digital flüssig - nicht angeeignet oder als Eigentum festgeschrieben werden könne, obgleich sie doch im kontrollierten Körper (bioport) massiv wirke, einem umfassend diskursivierten und technologisch hergestellten Körper. Donna Haraway hatte diesen Körper schon früh als ein „flüssiges, verstreutes, vernetztes technisch-organisches-textuell-mythisches System“ bezeichnet. Der sexuelle Körper ist das Produkt einer sexuellen Teilung des Fleisches, wobei jedes Organ durch seine Funktionalität gekennzeichnet ist. Mit Haraway schreibt Preciado (in leichter Absetzung von Foucault) von einer Techno-Biomacht, die das gesamte Leben technologisch reguliere, statistisch protokolliere und höchst produktiv verwalte. Viren, Hormone, Stimmen, Bilder, Internet, Medikamente und Pille werden als Werte in die globale bio-elektronische Erregungsmaschinerie integriert. Die diesen jenseits von Leben und Tod existierenden Techno-Körper antreibende Kraft ist die potentia gaudendi, die das Kapital bio- oder thanatopolitisch verwaltet, kontrolliert und produktiv macht, das letztere im Rahmen eines durchaus profitablen Managements der diversen Industrien bis hin zur Finanzindustrie. Der orgasmischen Kraft schreibt allerdings Preciado ein Potenzial zu, molekulare Freude zu produzieren, die nicht verbraucht werden könne, also unendlich sei, auch wenn mit dem technisch supplementierten pharmapornographischen Körper alles daran gesetzt werde, die orgasmische Kraft auf nacktes Techno-Leben zu reduzieren.
Die Pharma-Porno-Industrie sei zum paradigmatischen Modell der Kapitalakkumulation geworden, einerseits mit ihrem Modell des minimalen Einsatzes, der direkten Verkäufe und der unmittelbaren Konsumbefriedigung, basierend auf der niemals endenden somatischen Kette von Erregung–Frustration–Erregung, andererseits angetrieben von neuen Materialien wie Sperma, Blut, Testosteron, Adrenalin, Östrogene etc. sowie Zahlen, Semiotypen und Zeichen. Die darin fungierende, pornofizierte Arbeit ziele einzig auf Erregung (und frustrierende Befriedigung), während das globalisierte Kapital diese Prozesse nur noch produktiv verwalte, wie es auch die Körper, Patente und Copyright kontrolliere. Alle werden zu Arbeitern einer globalen Pornofabrik, die mit körperlichen Flüssigkeiten, synthetischen Hormonen, Silikon, Stimulanzien und Stimmungs-Regulatoren und digitalen Zeichen gefüllt ist. Sexuelle Arbeit transformiert die potentia gaudendi in Waren. Préciado spricht hier ausdrücklich von einer Pornifizierung und nicht von einer Feminisierung der Arbeit.
Preciado stellt sich eine ähnliche Frage wie Lyotard: Inwiefern ist das Libidinöse ein Konstituens des heutigen Kapitals und wie ist das Kapital am Libidinösen interessiert? Preciado spricht von einer toxi-pharma-pornographischen Ökonomie, und diesen Term benutzt sie als einen Panoramabegriff, der insofern eine Scharnierfunktion erfüllt, als er auf die Analyse der Bedingungen einer sozio-ökonomischen Gesamtheit verweist, und damit zumindest einen symptomalen Status besitzt, wenn er die Bedingungen für die Konstitution dieser Gesamtheit nicht selbst setzt. Bruno Latour hat auf solche Panoramen hingewiesen, sog. 360-Grad-Darstellungen des sozialen Raums. Und diese Panoramabegriffe bleiben fragwürdig, egal ob man nun von Risikogesellschaft, Prekarisierungsgesellschaft oder dem pharmapornokologischen Regime spricht. Der Wille zur Totalität ersetzt an dieser Stelle die kritische Analyse der Ökonomie.
Wenn Preciado weiterhin mit McLuhan annimmt, dass die globalen Informationstechnologien eine Ausdehnung eines monströsen Techno-Körpers seien, dann bleibt sie doch einem sehr alten Technodiskurs verhaftet, nämlich dem der Technik als einer Erweiterung der menschlichen Organe und Kognitionen. Noch weniger nachvollziehbar ist dann die Aussage, dieser Körper sei heute als eine Ausdehnung der Informationstechnologien zu verstehen. In dem von Preciado übernommenen Technikdiskurs muss man den Leib, damit er als abbildendes Projektionszentrum für die Technik irgendwann überhaupt noch gelten kann, als Triebzentrum beschreiben. Infolgedessen wird es unmöglich, die technischen Objekte weiterhin als rein gestaltähnliche Abbildungen oder quantitative Erweiterungen des Leibes zu imaginieren, vielmehr muss man in ihnen das Resultat generativer Projektionen sehen, eben des Triebes oder des Techno-Körpers und letztendlich des menschlichen Hirns, womit es dann allein auf Funktionsähnlichkeiten zwischen der Maschine und dem Techno-Körper/Hirn ankommt. Wenn Produktivität nur als die Transformation von Energien Bestand hat und nicht das Resultat eines leiblichen Triebüberschusses ist (Einwirkung leiblicher Organe und ihrer Funktionen auf die äußere Natur), so kann man endlich die meta-physische Energie eines Techno-Körpers und/oder Verstandes voraussetzen, die die Fähigkeit besitzt, Verdopplungen, Axiomatiken und Kompliziertheiten der Maschinen neu zu erzeugen. So erst kann die Philosophie voll in den Technikdiskurs einsteigen!
Pornographie ist für Preciado die zum Spektakel, zur Virtualität und zur digitalen Information mutierte Sexualität. Sie ist das neue Paradigma der Kulturindustrie, obgleich sie ihren Underground-Status nicht überwinden kann; ihre Kennzeichen sind Performance, Virtuosität, Theatralisierung, technische Reproduzierbarkeit, Digitalität und audiovisuelle Verbreitung. Porno beinhaltet das Management des Erregungs-Frustrations-Zirkels. Und die Kulturindustrie will exakt denselben physiologischen Effekt erzeugen, sei es etwa die Popmusikindustrie oder der Fußball. Pornographie ist Sex-Performance, Fußball ist Sport-Performance, Pop ist Kunst-Performance – zusammen bilden sie die hegemoniale Kette der öffentlichen Darstellung regulierter und zugleich kapitalisierter Wiederholung bzw. der öffentlichen Exerzitien regulierter Wiederholungen, die dem globalen Regelkreis von Erregung-Frustration-Erregung folgen. Porno mag hier eher mit Freak Shows und Zirkus zu tun haben als mit dem Kinematographischen des Fußballs und des Pop. (Die letzte Woche stattgefundenen Razzien in Berlin, im speziellen im Multimedia-Bordell Artemis, könnte man auf den Panama-Papers-Druck zurückführen. Woran sich heute kaum jemand mehr erinnert und worauf Preciado dankenswerter Weise hinweist - das Artemis wurde von der deutschen Regierung anlässlich der WM 2006 zum Bau freigegeben. Das Multimedia-Bordell, Teil der Kette aus Fußball-Porno-Pop, bleibt im öffentlichen Raum ein Ausnahmeort. Wenn die Politik nun aktuell wieder massiv versucht, die Sexindsurtie aus der Stadt zu drängen, dann ist das auch Teil einer Säuberungsaktion, die den durch die Veröffentlichung der Panama Papers wieder etwas erhöhten miesen Geruch von Korruption, der auch das Kapital erfasst, ob es will oder nicht, leicht ins Reine parfürmieren will. Korruption, das ist der Stallgeruch von Fußball, Sexindustrie, Drogenhandel etc., mit dem zwar die Finanzindustrie etwas anfangen kann, wenn er sich denn kapitalisieren lässt, aber der Staat als moralisierende Instanz muss regulieren und Sicherheiten injizieren (indem er bspw. Delinquenz erzeugt). Dabei spielt er sich auch gerne einmal als Staatsfeminist auf, der gerade entdeckt hat, dass Werbung sexistisch ist, worauf die Verbotsfeministinnen freudig einstimmen, dass dieser Schmuddelkram von der öffentlichen Bildfläche endgültig zu verschwinden habe. Es soll nur ja keiner auf die Idee kommen, die Pornoindustrie als Teil einer Werbe- und Kinoindustrie bzw. der Kulturindustrie zu betrachten, zudem von Migrantinnen durchsetzt, und auch deswegen soll die Pornoindustrie im Zuge eines rassistischen Diskurses der Mittelklassen und des Kapitals wieder stärker reguliert werden.)
Porno macht das als privat gedachte Szenario öffentlich, indem er andauernd Bilder mit stimulierenden Eigenschaften erzeugt, die sowohl beim Produzenten als auch beim Konsumenten biochemische und muskuläre Mechanismen der Lust freisetzen. Das Porn-Dispositiv privatisiert den öffentlichen Raum und lädt ihn mit masturbatorischem tele-medialen Wert auf. Die audiovisuelle Digitalisierung findet auf verschiedenen Plattformen statt (Fernsehen, Smartphone, Computer), die im Kontext des Erregungs-Frustrations-Kreislaufs eine Vervielfachung ermöglichen - in Los Angeles saugt ein Mund und in vielen Orten rund um die Welt kommt es zu Entladungen. Für Preciado zeigt sich der Zusammenhang zwischen Pornoindustrie und Kulturindustrie wie folgt. Im Zuge von Judith Butler begreift Preciado das Geschlecht und später mit Anni Sprinkle den Sex als performativen Akt, der zur Internalisierung von Normen, der Stilisierung und der Inszenierung der Körper im öffentlichen Raum führt. Porno inhäriert ein spezifisches Repräsentationssystem oder ein Darstellungsdispositiv, das in das Bild oder den Videofilm hinein wandert, dessen Konstituien wiederum Theatralisierung, Inszenierung und Licht sind. Im Pornofilm wird die Lust einzig zum Zweck der Erregung der Konsumenten visualisiert, es handelt sich um ein sowohl optisches als auch pragmatisch-chemisches Dispositiv, das die dargestellten und darstellenden Lustmaschinenkörper mit Hilfe der technischen Möglichkeiten des Schnitts ins Irreale bzw. A-topische abgleiten lässt, denn die Lust kennt im pornografischen Set ja anscheinend keine Erschöpfung und auch kein Ende, vielmehr wird diese allein zum Zwecke der Erregung der Zuschauer visualisiert. Ganz im Gegensatz zur Orgie bei Sade, die einer Dramaturgie der zerstörenden Überschreitung folgt (welche das zu Überschreitende und damit das Verbotene voraussetzt), um die Erregung durch die (sprachliche) Kombination von Sex, Philosophie und Verbrechen einzufordern und sie bis hin zum Ziel der Orgie (meistens Mord und/oder Inzest) auch zu steigern, obwohl über die Stellungen (elementare Einheit in der Orgie) genauestens Buch zu führen ist -, ganz im Gegensatz dazu kennt bspw. der Gangbang weder bei den Beteiligten noch bei den Rezipienten die Idee/Praxis der Überschreitung. Der Gangbang negiert selbst die fantastischsten Turnerpyramiden de Sades, mit denen dieser die Orgie berechenbar macht, sie sozusagen normalisiert, und was von der Orgie im Pornofilm übrig bleibt, ist die spröde Vernunft des Profits, die neutrale Konstruktion des Addierens und Kopulierens. Die Teilnahme an einem Gangbang ist für den Newcomer im Pornobusiness ein Sprungbrett auf der Karriereleiter nach oben. Gangbangpartys versammeln in der Regel ein Minimum an Frauen, die ein Maximum an Männern befriedigen. Gangbangs addieren & optimieren, erhöhen fast fahrplanmäßig die Sexualfrequenz.. Dennoch, Lustmaschinen sind immer auch Frustmaschinen.
Gonzo (die reine Darstellung des Geschlechtsakts und der Verkettung von Partialobjekten im Pornofilm, ohne jeden Hauch einer den Akt umrahmenden Handlung) scheint deswegen so erregend und schal zugleich zu wirken, weil man schon so viele Filme gesehen hat. Die Lust will aber Wiederholung. (Zunächst wiederholt die Wiederholung nicht die Vergangenheit, so wie sie tatsächlich war, sondern deren Virtualität, die man eben nicht nur der Zukunft, sondern auch der Vergangenheit zugestehen muss.) Beim Pornofilm ist die Struktur der Wiederholung allerdings eher der Ähnlichkeit bzw. der bloßen Kopie zugeneigt, wobei der Film eine spontane Aktivität, so scheint es jedenfalls, jenseits des Triebaufschubs und der Sublimierung (die genau genommen auch wiederholbar, also verschiebbar ist) bis in das letzte Detail ausleuchtet und kodifiziert, um beim Zuschauer eine Erregung zu erzeugen. Körperdesign, Sprache & Geräusche, Stellungen & Szenen, Kameraeinstellungen & Licht unterliegen im Pornofilm einer strengen Kanonisierung. Darüber hinaus inszenieren die Filme und Clips (mit Hilfe der Schnitttechniken) das ewige Phantasma, dass es Sex so einfach gibt, überall, egal ob bei der Autopanne, beim Fernsehen oder am Strand. In ihrer Rolle als verkörperte Erregungsmaschinen können die Akteure immer und sie können alles. Diese Fiktion faket die Sexualität, vor allem im Film, der die Imagination des Zuschauers nicht, wie beispielsweise den Leser pornophiler Texte, in der Schwebe hält, sondern durch die Abbildung und Darstellung unmittelbar zuschlägt. Während Sade alles sagen will, will der Sexfilm alles zeigen. So substituiert der Pornofilm in Permanenz das Authenzitätswollen der Einbildungskräfte und der Subjekte, deren Begehren inmitten der Bilder/Filme, die vermeintlich nur ein Reales konnotieren, stabilisiert und zugleich destabilisiert wird. Die chemisch-elektronischen Bilder des Pornofilms evozieren eine sexuelle Stimulation, die durch Triebabfuhr einen Kreislauf in Gang setzt, der des Partners und des Realen nicht mehr bedarf. Der Imperativ eines Genießens, das in der normalisierten Variante der Werbeindustrie den Sex ohne Körper serviert, zieht die Produktion von Bildmaschinerien nach sich, die ein programmatisches Interesses an dem Konsum von Sexualität befriedigen.
Porno wird für Preciado durch eine Art “spermatischer Platonismus” reguliert, in dem vor allem Cumshot real ist. Porno produziert die Illusion der potentia gaudendi, wenn die Erregung und ihr Abbau eine mehr oder wenige unwillkürliche Antwort auf die Ejakulation, einem Akt der Desubjektivierung, ist, auf den man mit der eigenen Desubjektivierung antwortet. Pornographie erzählt die performative Wahrheit über die Sexualität, das heißt sie produziert Wiederholungen im öffentlichen Raum und bleibt immer in den Regelkreislauf Erregung-Frustration-Erregung integriert. Man kann nun zwar behaupten, das der Sex und die Körper im Porno unrealistisch seien, aber gerade das Fiktive beinhaltet die platonische normative Form, um die sich der industrielle Komplex von Geschlecht und Sex zirkuliert. Die Kulturindustrie versucht die Pornoindustrie zu moralisieren, ihren Praktiken, Organen und Zeichen einen nicht-kinematographischen Charakter zuzusprechen, das heißt sie zu denunzieren, um sie im selben Augenblick hinsichtlich der Sexualisierung der Produktion, der Informatisierung der Körper und der Aufrechterhaltung des Erregungs-Frustrations-Kapitals Kreislaufs anzuzapfen. Schließlich ist Porno ein Medien- wie ein Kunst- wie ein Pop-Produkt.
Henryk Grossmann 2.0: A Critique of Paul Mason’s Book “PostCapitalism: A Guide to Our Future”

1. Introduction
In 1857, Karl Marx (1857/1858, 161) described the emergence of “institutions […] whereby each individual can acquire information about the activity of all others” and can build “interconnections”. So it seems like it was not Tim Berners Lee, but Karl Marx, who invented the World Wide Web (see Fuchs 2014a, 17)! What sounds like a description of the Internet, was in fact an analysis of the lists of current prices that were important information sources for the organisation of trade in the 19th century. Marx was not just a theorist of capitalism, but also one of communications (see Fuchs 2016d, 2009; De La Haye 1980) or what he termed the means of communication. It is therefore no surprise that not just the capitalist crisis, but also the rise of the Internet has led to an interest in Marx today. We have seen the emergence of what can be termed digital Marxism (see for example: Dyer-Witheford 1999, Fisher and Fuchs 2015; Fuchs 2014a, 2014c, 2015a; Fuchs and Mosco 2012, 2016; Huws 2003, 2014). The journalist Paul Mason tries to join the field of digital Marxism with a popular science book titled PostCapitalism. The work’s task is to show how information technology has created foundations of what Mason calls a post-capitalist economy.2. Long Waves of Economic Development: Kondratieff, Schumpeter and Marx
Paul Mason sees post-capitalism as a consequence of information technology: “Postcapitalism is possible because of three impacts of the new technology in the past twenty-five years” (xv): 1) the blurring of boundaries between labour and free time, 2) the abundance of information, 3) collaborative digital peer production. “The main contradiction today is between the possibility of free, abundant goods and information and a system of monopolies, banks and governments trying to keep things private, scarce and commercial” (xix). This analysis overestimates information economy because capitalism is not just digital and informational capitalism, but at the same time financial capitalism, hyper-industrial, fossil fuel capitalism, mobilities capitalism, etc. (Fuchs 2014a, chapter 5). Mason argues for a long wave theory of crisis and capitalism that combines Kondratieff’s long wave theory (that assumes that capitalist development has the form of 50-year long cycles consisting of 25 years of economic upswing followed by 25 years of downswing) and Marx’s theorem of the tendency of the rate of profit to fall (TRPF). The fifth long wave’s “takeoff has stalled” (47) because of neoliberalism and information technology (48). “[F]irms use profits to pay dividends rather than to reinvest” (71). Factors enabling neoliberalism would have been “fiat money, financialisation, the doubling of the workforce, the global imbalances, including the deflationary effect of cheap labour, plus the cheapening of everything else as a result of information technology” (106). For Mason, the fourth cycle lasted from the late 1940s until 2008 (72) and was driven by “transistors, synthetic materials, mass consumer goods, factory automation, nuclear power and automatic calculation” (48). He argues that in contrast to Joseph Schumpeter’s assumptions, innovations and the adoption of new technologies do not stem from entrepreneurial inventiveness, as Schumpeter argued, but from working class struggles that force capitalism to reinvent itself (75-76). The key technologies of the stalled fifth cycle would be “network technology, mobile communications, a truly global marketplace and information goods” (48). The combination of Kondratieff and Marx in a Marxist version of long-wave theory as alternative to Schumpeterianism is not new. Paul Mason completely ignores and does not seem to be aware of Ernest Mandel’s work, especially his book Late Capitalism (Mandel 1975; for a discussion, see: Fuchs 2016d, 151-152, 211). Mandel argued that there are long waves in the development of the rate of profit and that the 4th long wave’s downswing was initiated around 1967. Like Mandel, also Mason assumes that the tendency of the rate of profit to fall drives long waves that last fifty years: “The tendency of the rate of profit to fall, interacting constantly with the counter-tendencies, is a much better explanation of what drives the fifty-year cycle than the one Kondratieff gave” (p. 77). Mandel wrote in his 1972 PhD dissertation Late Capitalism: “The history of capitalism on the international plane thus appears not only as a succession of cyclical movements every 7 or 10 years, but also as a succession of longer periods, of approximately 50 years. […] An economic upswing is possible only with a rising rate of profit, which in its turn creates the conditions for a fresh extension of the market and an accentuation of the upswing. At a certain point in this development, however, the increased organic composition of capital and the limit to the number of commodities that can be sold to the ‘final consumers’ must both lower the rate of profit and also induce a relative contraction of the market. These contradictions then spill over into a crisis of over-production. The falling rate of profit leads to a curtailment of investments which turns the downswing into a depression” (Mandel 1975, 120, 439). Mason like Kondratieff, Schumpeter and Mandel assumes that “fifty-year cycles are the long-term rhythm of the profit system” (77). But Mason’s own claims contradict this metaphysical assumption that the wave-length is fixed to 50 years: He in other places in the book argues that the fourth wave was 60 years long (72). Given that capitalism is a complex, dynamic, open system (Fuchs 2004, 2008b, 2002), the deterministic assumption that there are long waves that last 50 years is simply not feasible (for a more detailed version of this argument, see: Fuchs 2016d, 150-159). Other than neo-Schumpeterians such as Christopher Freeman and Carolta Perez, Mason rejects the assumption that the information technology paradigm is resulting in a new long wave with sustained growth. The reason why he does so is however not scepticism of deterministic, undialectical and instrumental logic, but another form of determinism: Paul Mason assumes, as we will see, that information technology has to result in the breakdown of capitalism.3. Karl Marx
“Marx could not take into account the major phenomena of the twentieth century – state capitalism, monopolies, complex financial markets and globalization” (54). Obviously Marx did not live in the 20th century. But he was a very anticipatory thinker and, other than Mason claims, indeed very well understood globalisation, monopolies, and finance. Already in the Communist Manifesto, Marx and Engels pointed out the connection of capitalism, globalisation and technology, arguing for example that capitalism “has given an immense development to commerce, to navigation, to communication by land. This development has, in its turn, reacted on the extension of industry. […] [Capital] must nestle everywhere, settle everywhere, establish connexions everywhere” (Marx and Engels 1848, 486, 487). Eric Hobsbawm (2011, 112) argues in this context that today we can because of new communications and a new round of globalisation “see the force of the Manifesto’s predictions more clearly than the generations between us and its publication”. It is also simply not true that Marx did not see capitalism’s monopoly tendency. This tendency is a key aspect of what Marx in Capital Volume 1 calls the historical tendency of capitalist accumulation. This tendency involves the “centralization of capitals” because of the “immanent laws of capitalist production itself” so that one “capitalist always strikes down many others” (Marx 1867, 929). Marx also saw the speculative dimension and crisis tendency of financial capital in his analysis of what he termed fictitious capital in Capital Volume 3. He spoke of finance as “an entire system of swindling and cheating with respect to the promotion of companies, issues of shares and share dealings” (Marx 1894, 569). Against Paul Mason, we have to stress that Marx anticipated many of 20th century capitalism’s development tendencies. Capitalism develops dialectically through crises that result in sublations (what Hegel called “Aufhebung” in German) that bring about the emergence of relatively unpredictable changes. Crises are bifurcation points that destabilise the system. Marx’s theory itself is dialectical and historical, which means that it formulates the basic foundational structures and tendencies of capitalism, but needs to be adapted and sublated for the analysis and critique of the political economy of every specific phase of capitalist development. This does not mean that Marx is unsuited for the analysis of contemporary capitalism, but rather that the basic tenants of his analysis form the foundations for a dialectical analysis of 21st century capitalism and all other epochs of capitalism and class society as well as of society in general (see also Fuchs 2016a, 2011).4. Marx’s Grundrisse and Informational Exceptionalism
Paul Mason uses the assumptions of the neo-classical theory of economic goods for formulating a hypothesis of informational exceptionalism: “Info-goods change everything” (116) because they are non-rival and non-exclusive in consumption (118) and “can be reproduced for free” (117). Information would therefore undermine the price mechanism, result in the emergence of a contradiction between artificial capitalist information monopolies and “[p]eer-produced free stuff” (143) as well as in an alternative non-market info economy consisting for example of Wikipedia, Wikileaks, open source, creative commons, free software, etc. Paul Mason echoes Jeremy Rifkin’s (2015) claim of the emergence of a zero marginal cost society: The convergence of communication technology, energy technology and transport technologies in an Internet of things according to Rifkin fosters a near-zero marginal cost society, in which the “marginal cost of producing and distributing” information plummets “to near zero” (Rifkin 2015, 5) so that collaborative commons emerge that give momentum to a “transition from the capitalist era to the Collaborative Age”, can “heal the biosphere and create a more just, humane, and sustainable global economy for every human being on Earth in the first half of the twenty-first century” (Rifkin 2015, 380). Both Paul Mason and Jeremy Rifkin are very optimistic that information technology ushers in capitalism’s end and has to result in a better world that transcends capitalism. Such an assumption is not just optimistic, but also techno-deterministic. It underestimates the antagonistic character of digital capitalism and its imperialistic tendency to create new inner colonies of exploitation. Mason’s analysis of post-capitalism is based on a particular reading of Marx’s Fragment on Machines in the Grundrisse (Marx 1857/58, 690-714) that has been advanced by one theoretical tradition within Autonomist Marxism. This tradition involves authors such as Antonio Negri, Michael Hardt, Carlo Vercellone, Yann Moulier Boutang, Maurizio Lazzarato, and Paolo Virno, to whom Mason refers positively when interpreting the Fragment. According to this interpretation, the rise of an information economy or what these authors term “cognitive capitalism” invalidates the law of value, completely destroys labour time as the source of value, makes value immeasurable and “immaterial”, and thereby fosters crisis and the transition to communism. Marx’s Grundrisse would show that “a machine that lasts for ever, or can be made with no labour, cannot add any labour hours to the value of the products it makes” (167). Mason says that in the information economy, a “world of free stuff cannot be capitalist” (142), “information corrodes value” (143), and “value vanishes” (170). He argues that information technology creates a timeless economy that is independent from labour time: “Useful stuff that can be made with tiny amounts of human labour is probably going to end up being free, shared and commonly owned” (164). “Info-tech is just the latest outcome of an innovation process lasting 250 years. But information injects a new dynamic. Because with info-tech you can have machines that cost nothing, last for ever and do not break down” (164). “The real wonder of information is not that it is immaterial but that it eradicates the need for labour on an incalculable scale” (165). “Technologically, we are headed for zero-price goods, unmeasurable work, an exponential takeoff in productivity and the extensive automation of physical processes. Socially, we are trapped in a world of monopolies, inefficiency, the ruins of a finance-dominated free market and a proliferation of ‘bullshit jobs’. Today, the main contradiction in modern capitalism is between the possibility of free, abundant socially produced goods, and a system of monopolies, banks and governments struggling to maintain control over power and information. That is, everything is pervaded by a fight between network and hierarchy” (144). Mason argues that there are “structural obstacles” (173) to the emergence of info-capitalism: zero costs, zero price, the problem of reskilling, and human resistance to commodification. “So what we have in reality is an info-capitalism struggling to exist. We should be going through a third industrial revolution but it has stalled. […] An economy based on information, with its tendency to zero-cost products and weak property rights, cannot be a capitalist economy” (175). In an appendix to the book Reading Marx in the Information Age, I have focused on the Grundrisse’s “Fragment on Machines” (Fuchs 2016d, 360-375) and have discussed the version of autonomist Marxism to which Paul Mason relates to in detail. One main problem of this interpretation is that it misreads the Fragment, especially that passage, where Marx writes that “labour time ceases and must cease to be” the measure of wealth (Marx 1857/58, 705). This peculiar version of Autonomism assumes that this formulation implies that the rise of information technology and cognitive capitalism abolishes the law of value within capitalism and results in the automatic transition to cognitive communism. But Marx makes clear that the context of the situation he describes is that the “mass of workers” has appropriated “their own surplus labour” (Marx 1857/58, 708) and that “production based on exchange value breaks down” (705). Marx speaks of the breakdown of the law of value in post-capitalism, not in capitalism! As long as capitalism exists, the law of value institutes the exploitation of labour in space and time. Information technology advances the contradiction between the productive forces and the relations of production, but does not invalidate the law of value. Roman Rosdolsky (1977, 428) in his seminal study of Marx’s Grundrisse argued in this context that Marx in the Fragment had the “withering away of the law of value under socialism” in mind, but not under capitalism. Moishe Postone (2008, 126) stresses the crisis of value in capitalism is “not simply superseded by a new form of wealth”, but rather value “remains the necessary structural precondition of capitalist society”. “Capitalism does give rise to the possibility of its own negation, but it does not automatically evolve into something else” (Postone 2008, 127). Rosdolsky’s study of the Grundrisse and the works of Postone, who is one of the major Marxist value critics, are just two of the Marxist works that Mason is obviously not aware of, which results in a one-dimensional, deterministic interpretation of the labour theory of value. Mason also ignores the state of the art in discussions about the digital labour theory of value (see Fisher and Fuchs 2015, Fuchs 2014a; Fuchs 2015a, chapters 4-6). This is a fairly complex and multidimensional debate, in which there are multiple strands of thought that foreground different categories, such as productive digital labour, the collective worker, the sphere of circulation, rent, advertising as ideological transport labour, reproductive labour, consumption work, audience and user labour/commodification, the political economy of targeted online advertising, or immaterial labour/cognitive capitalism. Mason only relies on the latter category and interpretation of the digital labour theory of value. Although the copying time of information is very small, there are ways of how capital tries to institute new forms of labour-time, value creation and exploitation in the information economy. First, commercial software and other information goods are not just produced once and then copied, but there are often new versions, constant updates, and forms of support labour. It is therefore no surprise that the number of annual hours worked in the sector of IT and other information services (that includes software engineering among other types of work) has for example in Germany increased from 765 million annual hours in 2000 to 1.069 billion in 2010 (data source: OECD STAN). Second, one has to see that large parts of the Internet’s political economy are based on targeted advertising. The advertising industry is just a footnote in Mason’s analysis, although global advertising revenue grew from £234 billion in 210 to £283 billion in 2014 (Ofcom 2015). The share of online advertising in total advertising has been rapidly increasing, contributing to the crisis of commercial print media. Google and Facebook are not communications corporations. They are the world’s largest advertising companies (Fuchs 2014c). Advertising is not just based on the labour-time of marketing professionals, but also on the attention time of audiences and on commercial Internet usage time that is (unpaid) labour time. Dallas Smythe’s theory allows us to understand this phenomenon in the context of the blurring of the boundaries between labour and leisure and between toil and play (Fuchs 2014a, 2014c, 2015a). Third, there is an international division of digital labour, in which various forms of labour are organised (Fuchs 2014a, 2015a). It ranges from the exploitation of enslaved miners in the Congo, Tayloristic ICT assemblers at Foxconn in China, or software engineers in India or the Silicon Valley to various forms of unpaid online labour (ibid.). The production of information technology is highly exploitative and time-consuming. The assumption of value collapse in the information economy underestimates the dangers of actually existing exploitation in the capitalist world economy. Fourth, there are various forms of irregular, unpaid, precarious, outsourced, crowdsourced, and click-worked digital labour. Examples include the usage of Facebook, Google, YouTube, Weibo, LinkedIn, Pinterest and Instagram; online customer reviews on Amazon or Yelp; work via freelancer platforms such as Upwork, PeoplePerHour, Amazon Mechanical Turk and ClickWorker; the participation in customer surveys, installing software updates, deleting spam, unsubscribing from spam lists, the time spent on online daring platforms such as match.com or Tinder, answering professional e-mails via the mobile or tablet out of regular working hours, working on the train, tube or in cafés; online travel booking, etc. Unpaid labour and productive consumption that creates value goes beyond the Internet: Think of self-service gas stations, the self-assemblage of IKEA furniture, housework, commuting time, washing your garbage before disposing it, ATMs, self-check out machines in supermarkets, the culture of unpaid internships, check-in machines at airports, ticket vending machines at tube, train and bus stations, automated service kiosks in privatised post offices, automated vending machines, self-service bars in restaurants, fast food restaurants, etc. “Shadow working includes all the unpaid tasks we do on behalf of businesses. […] Customers pump their own gasoline, draft their own bear, serve their own frogurt, and scoop up bagfuls of basmati rice and then label them, at the bulk-food section of Whole Foods. They fill plates at salad bars and ladle soups, lo mein, mac and cheese, or scrambled eggs from the soup bars. […] With 3-D printers, they need only download design to ‘print out’ many objects they would have bought at a store not long ago. This is home manufacturing” (Lambert 2015, 1, 251-252). Consumer and prosumers labour is shadow work because it does not in an obvious way feel like work, but creates value for corporations. It takes time. And it takes time away that could be used outside the commodity culture. It substitutes paid labour by precarious and unpaid labour and by reducing corporations’ wage-sum helps increasing their profits. Consumers and users have become part of the working class. I am not arguing for upholding stupefying labour that could much better be conducted by machines, but rather want to stress that the contradictions that Marx describes in the Fragment have in the age of information technology become so acute that the automation and digitisation of labour result not just in unemployment, but also new forms of exploitation that are often not just precarious, but also unseen and hidden. That the law of value has not died becomes evident if one looks at the largest transnational digital media corporations that make massive profits. In 2015, Apple was the world’s 12th largest transnational corporation with annual profits of US$ 44.5 billion. Microsoft was the 25th largest (annual profits: US$ 20.7 bn), Google the 39th largest (US$ 13.7 bn), IBM the 44th largest (US$ 12 bn), Comcast the 46th largest (US$ 8.4), Disney the 84th largest (US$ 7.8 bn), Hewlett-Packard the 96th largest (US$ 5 bn), Foxconn the 122nd largest (US$ 4.3 bn), 21st Century Fox the 150th largest (US$ 9.3 bn), Time Warner the 163rd largest (US$ 3.8 bn), etc. (data source: Forbes 2000, 2015 list). These profits do not fall from heaven and are not created out of nothing. They are the result of capital’s exploitation of paid, unpaid, precarious, outsourced, or crowdsourced digital labour-time that creates economic value in the international division of digital labour. The reason why the Internet economy is (like all parts of capitalism) prone to crisis is not that it lies beyond value and labour-time. Rather there are exaggerated ideological expectations that the rise of the Internet can compensate for the fall of profits in other parts of the economy. Every new development in the digital world results in a new version of digital sublime (Mosco 2004), i.e. techno-optimistic ideologies that fetishise the Internet and computing. The capitalist Internet therefore comes along with expectations of massive profit rates that diverge from actual economic reality. These surplus expectations go beyond the actual possibilities inherent in the exploitation of digital labour, which drives the financialisation of the Internet economy so that financial bubbles emerge that can burst as the dot.com-crisis showed in the year 2000. The rise of information technology has resulted in contradictions that have both created a new digital and consumer proletariat that is part of the global working class and financialised information monopolies that make informational capitalism prone to crisis. Digital and informational capitalism is not impossible, as Mason claims. It is a reality, in which we have to live today. The digital law of value has created new forms of exploitation as well as contradictions that allow the creation of new spheres of non-commercial, alternative, co-operative production and a solidarity, commons-based, and peer production economy outside the realm of capitalism that undermine the law of value. But the aim and tendency of destroying the law of value is not an automatism that flows from information and information technology. It can rather only be achieved in conscious political struggles for the decommodification of information, the economy and the world. It requires the dialectical political unity of the social movement crowd and the party (Dean 2016). “Crowds amass, but they don’t endure. […] [It is] the crowd that pushes the party to exceed expectations, [and] the party that finds the courage of the people in the haste of the crowd. […] [The] party works to extend the collective desire for collectivity after the crowds go home” (Dean 2016, 26, 260).5. Class Struggle and Political Change
Paul Mason fails to make a profound and significant contribution to digital Marxism. His analysis is a one-dimensional, techno-deterministic breakdown theory that ignores digital labour analysis, the international division of digital labour, and the contradiction between digital labour and digital capital. What Paul Mason is good at is identifying and describing political demands that can help to advance conditions for the creation of a post-capitalist society (see chapter 10). Such demands include the reduction of standard working hours; advancing support for co-ops, the solidarity and commons-based peer production economy; the reduction of carbon emissions, the strengthening of the welfare state and gratis public services, the reduction of inequalities, the socialisation of the finance system, fostering human-centred automation, ending privatisation, starting state-led infrastructure projects (housing, transport, healthcare, education, etc.), debt write-off, the closure of tax havens, a clampdown on tax avoidance, the introduction of a universal basic income funded from taxation, etc. (292). At least two ideas should be added and stressed: 1) There are different forms of tax-funded universal basic income – neoliberal and progressive basic income. In neoliberal basic income, the tax system is changed in such a way that the poor have a minimum income, but overall there is a redistribution from lower to upper income and wealth groups by measures such as flat taxation and the partial abolishment of the welfare state, which puts the first at a social disadvantage. It is no wonder that Milton Freedman embraced the idea of such a basic income. One version of neoliberal basic income is to abolish all taxes, except for VAT that is massively increased. Progressive basic income in contrast is a measure that combines universal economic rights with increasing the taxation of capital and the rich. Some years ago, I helped designing models of how progressive basic income could be implemented in the German-speaking world’s basic income movement. The contradiction between neoliberal and progressive basic income became very evident in this movement. My political point has in this context always been that I do not care about basic income as such, but only about a socialist and redistributive basic income. 2) Paul Mason sees the necessity to combine civil society and state politics in progressive politics. The problem of alternative projects has to do with the radical Left’s traditional scepticism of the state. Such projects often lack resources, remain an alternative ghetto for the enlightened left-wing few, are based on voluntary, highly self-exploitative labour, and as a result of all of this cannot challenge the power of capitalism. We need mechanisms that combine progressive state and civil society action. One of them is what I term the participatory media fee (Fuchs 2015b): Additional state revenues generated by capital taxation, for example by taxing advertising, are in this model redistributed via participatory budgeting to citizens, who receive a citizens cheque. They are required to donate the annual sum they receive to non-commercial media or cultural project that help advancing the public sphere. When discussing political change potentials, the question arises who the potential subjects of this change are. For Paul Mason, contemporary protestors constitute this political subject. So he sees the need for active, conscious political praxis. But given his techno-deterministic framework, it seems like such praxis is not relatively autonomous, but the automatic result of the blind necessity forced by information technology on society and human subjects. Protest appears in Mason’s account to be an automatic and necessary force of history. Such an analysis underestimates the role of ideologies that can forestall political change and political movements. Crises do not determine, but only condition political struggles. Crises as capitalism’s objective dialectical factor condition the possibilities for and limits of subjective contradictions, in which humans intervene collectively into society and try to change it. “Not the slightest natural necessity or automatic inevitability guarantees the transition from capitalism to socialism. […] The revolution requires the maturity of many forces, but the greatest among them is the subjective force, namely, the revolutionary class itself. The realization of freedom and reason requires the free rationality of those who achieve it. Marxian theory is, then, incompatible with fatalistic determinism (Marcuse 1941, 318-319; for a detailed discussion of Herbert Marcuse’s critical theory in the age of digital and social media, see Fuchs 2016b, chapter 4). Who exactly is the progressive political subject for Paul Mason? He speaks of “a new agent of change in history: the educated and connected human being” (xvii). “In the past twenty years, capitalism has mustered a new social force that will be its gravedigger, just as it assembled the factory proletariat in the nineteenth century. It is the networked individuals who have camped in the city squares, blockaded the fracking sites, performed punk rock on the roofs of Russian cathedrals, raised defiant cans of beer in the face of Islamism on the grass of Gezi Park, pulled a million people on to the streets of Rio and São Paulo and now organized mass strikes across southern China. They are the working class ‘sublated’ – improved upon and replaced” (212). Almost all managers, CEOs, and other members of the class of the 1% are “educated and connected”. They are the globalised, networked, educated, influential – and wealthy. Are the educated, connected and networked hedge fund manager and the educated, connected and networked entrepreneur, who parks and hides his wealth in tax havens, part of this subject? Definitely not! Education, networking and connectedness are not automatically politically progressive. When we assume that educated, connected, networked individuals are the progressive subject, then this means that the 1% must be the avant-garde of the Left, which is an absurd assumption. Also fascist leaders and activists can be educated and are mostly not just populists, but also highly connected and networked. We must see that a significant share of contemporary political action is fascist, racist or right-wing extremist in character. Not only is it relatively open if in a situation of crisis, protest emerges or is forestalled by ideologies and repression, also the dominant political direction of such politics is not determined. Paul Mason’s take of political change is naïve. This became also evident in his 2012 book Why It’s Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions (Mason 2012), in which he fostered the myth of contemporary protests being Facebook and Twitter revolutions. If one bases books on journalistic observations and not on systematic, critical empirical studies, then such short-circuited, one-dimensional analyses are the outcome. What Paul Mason observes as a journalist on some squares of the world and in his interviews can at best be a partial truth, half-truth or untruth. It is not based on a social science methodology. Empirical research has in contrast shown that online media neither cause contemporary protests and revolutions nor are they unimportant (see for example: Aouragh 2016, Fuchs 2014b, Gerbaudo 2012, Salem 2015, Wilson and Dunn 2011, Wolfson 2014). Protests are shaped by dialectics of mediation and the streets, the Internet and the squares, online and offline, face-to-face and mediated communication, traditional and new media (Fuchs 2014b). Sometimes it would be better that journalists go (back) to university and do PhDs in order to learn some social science and conduct systematic empirical research before they write books. Not the educated, connected, and networked form a political subject today. The potentially progressive political subject-in-itself is rather formed by all those whose labour produces the commons, but does not control, expropriate and dispossess the commons of nature, the social, knowledge, culture, technology, care, and education. The 1% are not part of this political subject, but rather form its dialectical opposite.6. Conclusion
Paul Mason’s book Post-Capitalism fetishises information technology. It ignores the role of digital labour and the contradiction between digital labour and digital capital in the international division of digital labour. It is based on a one-dimensional, functionalist reading of Marx and misses to understand digital capitalism’s imperialistic character (Fuchs 2016c). It sees human praxis as a blind necessity emanating from information technology and is based on a linear, techno-deterministic, functionalist logic: Information technology => Zero-marginal costs of information => Tendency of the Rate of Profit to Fall => Breakdown of capitalism => Post-capitalism “We need to be unashamed utopians” (288): Paul Mason is a utopian socialist 2.0, who sees the utopia of socialist post-capitalism not as the outcome of socialist praxis’ active hope, but as the result of information technology. The book stands in the tradition of other breakdown theories of capitalism. Although theoretically much less sophisticated, it is not unrelated to the German Marxist Robert Kurz’s approach. In books such as Der Kollaps der Modernisierung (Kurz 1991), Schwarzbuch Kapitalismus (1999), or Geld ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie (Kurz 2012), Kurz argues that the microelectronic revolution destroys the substance of value and results in an inevitable decrease of the rate of profit that leads to capitalism’s collapse and the emergence of a post-capitalist society: “Briefly, one can say that with the microelectronic revolution starting in the early 1980s, whose potential is far from being exhausted, not only the Fordist Expansion but the expansion of productive labor and therefore real value creation also stagnated; productive labor has since been in retreat on a global scale. This means that the historical compensation mechanism, which sustained the parallel expansion of capitalistically unproductive labor, no longer exists. The basis of capitalist reproduction has truly reached its absolute limit, although its collapse (in the fullest sense of the word) has not yet taken place on the formal phenomenological plane. But such an event would no longer merely take the form of an accelerated decrease in the rate of profit” (Kurz 1995). The analysis in Mason’s book also resembles the parent of all economic breakdown theories, Henryk Grossmann’s 1929 book Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen Systems (The Law of the Accumulation and Breakdown of the Capitalist System). Grossmann gives a mathematical example (based on a calculation that Otto Bauer [1912/1913] provided in an essay), in which capitalism breaks down after 35 years. He argues that the example shows that Marx’s theorem of the tendency of the profit rate to fall brings about the automatic breakdown of capitalism. “If the capitalist system inevitably breaks down due to the relative decline in the mass of profit we can understand why Marx ascribed such enormous importance to the tendential fall in the rate of profit, which is simply the expression of this breakdown” (Grossmann 1992, 119). “The capitalist mechanism falls sick not because it contains too much surplus value but because it contains too little. The valorisation of capital is its basic function and the system dies because this function cannot be fulfilled” (Grossmann 1992, 126). “Marx roots the breakdown in the social form of production; in the fact that the capitalist mechanism is regulated by profit and at a certain level of capitalist accumulation there is not enough profit to ensure valorisation of the accumulated capital” (Grossmann 1992, 127). Bauer calculated the development of the rate of profit in his example only for four years. Grossmann extended the calculation over 35 years (compare: Fuchs 2002, 254). The problem is that the example is constructed in such a way that the rate of surplus value remains constant while the organic composition of capital increases. In reality, class struggle on behalf of capital can increase the rate of surplus value and act as countervailing tendency so that class struggle is a crucial intervening variable in the development of the rate of profit (Fuchs 2016d, 348-350; Fuchs and Sandoval 2014; Fuchs and Garnham 2014, 125-126). Grossmann acknowledges the existence of countervailing tendencies, but argues that the breakdown tendency in the end must assert itself and must result in a final crisis: “Despite the periodic interruptions that repeatedly defuse the tendency towards breakdown, the mechanism as a whole tends relentlessly towards its final end with the general process of accumulation. As the accumulation of capital grows absolutely, the valorisation of this expanded capital becomes progressively more difficult. Once these countertendencies are themselves defused or simply cease to operate, the breakdown tendency gains the upper hand and asserts, itself in the absolute form as the final crisis” (Grossmann 1992, 85). Also Lenin (1964, 154) overlooked the negative aspects of technology when he idealised the Taylor system’s inhumanity and thought it was ready made for application in a socialist society: “The Taylor system – without its initiators knowing or wishing it – is preparing the time when the proletariat will take over all social production and appoint its own workers’ committees for the purpose of properly distributing and rationalising all social labour. Large-scale production, machinery, railways, telephone – all provide thousands of opportunities to cut by three-fourths the working time of the organised workers and make them four times better off than they are today”. The point is that capitalism and domination inherently shape the character of technologies. It is therefore unlikely that a technology in capitalism only has positive and emancipatory roles and potentials. Modern technology has contradictory tendencies that can support emancipation and repression. The point is that it is a political task to reshape both society and technology in an integrated manner so that democratic socialism can be advanced. The rate of profit depends on the organic composition of capital and the rate of surplus-value. It is directly proportional to the rate of surplus-value and indirectly proportional to the organic composition (Fuchs 2016d, 248-256, 347-351). Technological development can bring about an increase of both, so that an actual rise or fall of the rate of profit and the economic expression of the tendency depend on the results of class struggle and the degree of countervailing tendencies (Fuchs 2016d, 248-256, 347-351). There is no necessary breakdown of capitalism. Information technology only conditions, but does not determine capitalism’s objective and subjective contradictions and their development. The collective worker of the world has to politically unite in order bring about the humanisation of society and technology. Paul Mason is digital Marxism’s Grossmann 2.0. Such an assessment is the opposite of praise for a book. PostCapitalism: A Guide to our Future is successful in market terms (in capitalist ideological terms this means that it is a “bestseller”) not because of the superiority of its analysis, but because its author due to his journalistic activity has more than 200,000 Twitter followers and has become widely known by appearances on BBC and Channel 4’s news broadcasts. The stratification of media attention in the capitalist society of the spectacle results in a divergence of attention so that high levels of sales, revenues and attention can very well accompany low academic, theoretical and analytical quality. The poverty of theory sells if it blinks and screams glaringly and loud enough in the attention economy, even if it just imitates, copies and disguises itself as digital Marxism.References
Aouragh, Miriyam. 2016. Social Media, Mediation and the Arab Revolutions. In Marx in the Age of Digital Capitalism, ed. Christian Fuchs and Vincent Mosco, 482-515. Leiden: Brill. Bauer, Otto. 1912/13. Die Akkumulation des Kapitals. Die Neue Zeit 31 (1): 831-838, 862-874 De La Haye, Yves, ed. 1980. Marx and Engels on the Means of Communication. New York: International General. Dean, Jodi. 2016. Crowds and Party. London: Verso. Dyer-Witheford, Nick. 1999. Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High-Technology Capitalism. Urbana, IL: University of Illinois Press. Fisher, Eran and Christian Fuchs, eds. 2015. Reconsidering Value and Labour in the Digital Age. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Fuchs, Christian. 2016a. Against Theoretical Thatcherism: A Reply to Nicholas Garnham. Media, Culture & Society 38 (2): 301-311. Fuchs, Christian. 2016b. Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet. London: University of Westminster Press (Forthcoming publication). Fuchs, Christian. 2016c. Digital Labor and Imperialism. Monthly Review 67 (8): 14-24. Fuchs, Christian. 2016d. Reading Marx in the Information Age: A Media and Communication Studies Perspective on “Capital Volume I”. New York: Routledge. Fuchs, Christian. 2015a. Culture and Economy in the Age of Social Media. New York: Routledge. Fuchs, Christian. 2015b. Left-Wing Media Politics and the Advertising Tax. Reflections on Astra Taylor’s Book “The People’s Platform: Taking Back Power and Culture in the Digital Age“. tripleC: Communication, Capitalism & Critique 15 (1): 1-4. Fuchs, Christian. 2014a. Digital Labour and Karl Marx. New York: Routledge. Fuchs, Christian. 2014b. OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism. Winchester: Zero Books. Fuchs, Christian. 2014c. Social Media: A Critical Introduction. London: Sage. Fuchs, Christian. 2011. Foundations of Critical Media and Information Studies. London: Routledge. Fuchs, Christian. 2009. Some Theoretical Foundations of Critical Media Studies: Reflections on Karl Marx and the Media. International Journal of Communication 3: 369-402. Fuchs, Christian. 2008a. Foundations and Two Models of Guaranteed Basic Income. In Perspectives on Work, eds. Otto Neumaier, Gottfried Schweiger and Clemens Sedmak, 235-248. Vienna: LIT. Fuchs, Christian. 2008b. Internet and Society: Social Theory in the Information Age. London: Routledge. Fuchs, Christian. 2004. The Antagonistic Self-Organization of Modern Society. Studies in Political Economy 73: 183-209. Fuchs, Christian. 2002. Aspekte der evolutionären Systemtheorie in ökonomischen Krisentheorien unter besonderer Berücksichtigung techniksoziologischer Aspekte. In Christian Fuchs, Krise und Kritik in der Informationsgesellschaft: Arbeiten über Herbert Marcuse, kapitalistische Entwicklung und Selbstorganisation, 82-401. Norderstedt: Libri. Fuchs, Christian and Nicholas Garnham. 2014. Revisiting the Political Economy of Communication. tripleC: Communication, Capitalism & Critique 12 (1): 102-141. Fuchs, Christian and Nick Dyer-Witheford. 2013. Karl Marx@Internet Studies. New Media & Society 15 (5): 782-796. Fuchs, Christian and Vincent Mosco, eds. 2016. Marx in the Age of Digital Capitalism. Leiden: Brill. Fuchs, Christian and Vincent Mosco, eds. 2012. Marx is back – The Importance of Marxist Theory and Research for Critical Communication Studies Today. tripleC: Communication, Capitalism & Critique 10 (2): 127-632. Fuchs, Christian and Marisol Sandoval. 2014. Introduction: Critique, Social Media and the Information Society in the Age of Capitalist Crisis. In Critique, Social Media and the Information Society, ed. Christian Fuchs and Marisol Sandoval, 1-47. New York: Routledge. Gerbaudo, Paolo. 2012. Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism. London: Pluto Press. Grossmann, Henryk. 1992. The Law of Accumulation and Breakdown of the Capitalist System. Being also a Theory of Crises. London: Pluto. Hobsbawm, Eric. 2011. How to Change the World: Reflections on Marx and Marxism. New Haven, CT: Yale University Press. Huws, Ursula. 2014. Labor in the Global Digital Economy. New York: Monthly Review Press. Huws, Ursula. 2003. The Making of a Cybertariat. New York: Monthly Review Press. Kurz, Robert. 2012. Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformaion der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin: Horlemann. Kurz, Robert. 1999. Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft. Frankfurt/Main: Eichborn. Kurz, Robert. 1995. The Apotheosis of Money: The Structural Limits of Capital Valorization, Casino Capitalism and the Global Financial Crisis. https://libcom.org/library/apotheosis-money-structural-limits-capital-valorization-casino-capitalism-global-financi Kurz, Robert. 1991. Der Kollaps der Modernisierung. Frankfurt/Main: Eichborn. Lambert, Craig. 2015. Shadow Work. The Unpaid, Unseen Jobs that Fill Your Day. Berkeley, CA: Coutnerpoint Lenin, Vladimir I. 1964. Lenin Collected Works. Volume 20. Moscow: Progress. Mandel, Ernest. 1975. Late Capitalism. London: NLB. Marcuse, Herbert. 1941. Reason and Revolution. Hegel and the Rise of Social Theory. New York: Humanity Books. Marx, Karl. 1894. Capital. Volume 3. London: Penguin. Marx, Karl. 1867. Capital. Volume 1. London: Penguin. Marx, Karl. 1857/58. Grundrisse. London: Penguin. Marx, Karl and Friedrich Engels. 1848. In MECW, Volume 6, 477-519. London: Lawrence & Wishart. Mason, Paul. 2012. Why It’s Kicking Off Everywhere. The New Global Revolutions. London: Verso. Mosco, Vincent. 2004. The Digital Sublime. Cambridge, MA: MIT Press. Ofcom. 2015. International Communications Market Report 2015. London: Ofcom. Postone, Moishe. 2008. Rethinking Capital in the light of the Grundrisse. In Karl Marx’s Grundrisse, ed. Marcello Musto, 120-137. London: Routledge. Rifkin, Jeremy. 2015. The Zero Marginal Cost Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Rosdolsky, Roman. 1977. The Making of Marx’s “Capital”. London: Pluto. Salem, Sara. 2015. Creating Spaces for Dissent: The Role of Social Media in the 2011 Egyptian Revolution. In Social Media, Politics and the State: Protests, Revolutions, Riots, Crime and Politics in the Age of Facebook, Twitter and YouTube, ed. Daniel Trottier and Christian Fuchs, 171-188. New York: Routledge. Wilson, Christopher and Alexandra Dunn. 2011. Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive Analysis from the Tahrir Data Sets. International Journal of Communication 5: 1248–1272. Wolfson, Todd. 2014. Digital Rebellion. The Birth of the Cyber Left. Urbana, IL: University of Chicago Press.About the Author
Christian Fuchs Christian Fuchs is co-editor of the open access journal tripleC: Communication, Capitalism & Critique (http://www.triple-c.at). He is a professor at the University of Westminster, where he is the Director of the Communication and Media Research Institute (http://www.westminster.ac.uk/camri) and the Director of the Westminster Institute for Advanced Studies (http://www.westminster.ac.uk/wias). He is a member of the European Sociological Association’s Executive Committee. His books include “Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet” (2016, forthcoming), “Reading Marx in the Information Age: A Media and Communication Studies Perspective on Capital Volume 1” (2016), “Culture and Economy in the Age of Social Media” (2015), “Digital Labour and Karl Marx” (2014), “Social Media: A Critical Introduction” (2014), “OccupyMedia! The Occupy Movement and Social Media in Crisis Capitalism” (2014), “Foundations of Critical Media and Information Studies” (2011), “Internet and Society: Social Theory in the Information Age” (2008). He is the author of around 300 academic works in the fields of critical theory and the critique of the political economy of communications, digital media, the Internet, social media and the information society. http://fuchs.uti.at@fuchschristian taken from Triple C the article has a CC-BY-NC-ND licence Foto: Bernhard WeberAndrew Culp: Dark Deleuze – A Short Summary

 taken from here
2nd part here
taken from here
2nd part here
The Bad New: A Maxim and Twelve Theses for the Present Moment

Originally presented at “The Government of Times”, A symposium-performance curated by Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós in the context of the project “Capitalist Melancholia” (cur. by Francois Cusset, Camille de Toledo & Michael Arzt), Halle 14, Leipzig, 28 May 2016.
Foto: Bernhard Weber
Time’s Carcass: De-Fetishising Toxic Time

- Originally presented at “The Government of Times”, A symposium-performance curated by Aliocha Imhoff & Kantuta Quirós in the context of the project “Capitalist Melancholia” (cur. by Francois Cusset, Camille de Toledo & Michael Arzt), Halle 14, Leipzig, 28 May 2016.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Corium_(nuclear_reactor)